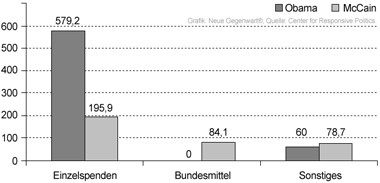|
Erfolgreiche Obama-Show
im Internet
Die Wahl zum 44. amerikanischen
Präsidenten hat die politische Kommunikation grundlegend verändert. Barack
Obamas erfolgreicher Online-Feldzug ins Weiße Haus revolutionierte alles,
was bislang zum Thema Medien und Wahlen als gesicherte Erkenntnis galt.
Klassische Printmedien verlieren an Bedeutung und politische Kampagnen ohne
das Internet an Wirkung. Das Web 2.0 erlaubte eine neue Form von
Wähler-Dialog und mehr Nähe zum Wähler.
Text:
Matthias Kurp
Bild:
©Obama
for America
Grafik:
Neue Gegenwart |

Das wäre in Deutschland
undenkbar: dreißig Minuten TV-Wahlwerbung zur besten Sendezeit. Da tritt der
Spitzenkandidat in der Pose des Staatsmannes auf und wird
pseudojournalistisch als fürsorglicher Landesvater in Szene gesetzt.
Millionen von US-Amerikanern lernten so sechs Tage vor der
Präsidentschaftswahl Barack Obama kennen. Das Infocommercial wurde bei CBS,
Fox und NBC ausgestrahlt. Die Schaltung des teuersten Wahlwerbespots der
Welt soll mehr als drei Millionen Dollar gekostet haben. Doch das war nur
ein Teil der politischen PR-Lawine: Hinzu kamen täglich Tausende kurzer
Radio- und TV-Commercials, die bei den großen Networks und lokalen Stationen
zu hören oder sehen waren. Das Werbeforschungsunternehmen Nielsen
registrierte eine Woche vor der Wahl täglich mehr als 3.000 Fernseh- oder
Funkspots. Nie zuvor konnte eine Partei oder ein Kandidat in einem Wahlkampf
mehr Geld ausgeben als Barack Obama beim Siegeszug gegen John McCain.
Spenden-Rekord dank
Internet
In den US-Wahlkampf wurden einschließlich der Vor- und Kongresswahlen 5,3
Milliarden Dollar investiert, so ermittelte das Center for Responsive
Politics, eine Nichtregierungs-Organisation, die im Auftrag der
US-Wahlkommission die finanziellen Beziehungen der
Kandidaten prüft. Das gesamte Spendenaufkommen (inklusive Vorwahlen) konnte
im Vergleich zu 2004 insgesamt etwa verdoppelt werden. Allein das Duell
Obama gegen McCain kostete etwa 2,4 Milliarden Dollar. Der neue US-Präsident
hatte dank des enormen Spendenaufkommens frühzeitig auf die staatlich bereit
gestellten 84 Millionen Dollar, auf die sein republikanischer Gegenkandidat
McCain zurückgriff, verzichten können. Stattdessen setzte Obama ganz auf den
Erfolg seiner Spendenaufrufe, die schließlich fast 640 Millionen Dollar in
die Wahlkampfkasse spülten. McCain verfügte hingegen nur über 360 Millionen
Dollar Einnahmen.
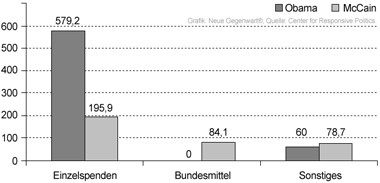
Als entscheidender Motor für die Mobilisierung von Spendern, Freiwilligen
und Wählern erwies sich das Internet. Millionen von Amerikanern erhielten
E-Mails und wurden gebeten, Barack Obama finanziell zu unterstützen. Mit
Erfolg: Fast 300.000
spendeten und stellten den Wahlkampf der Demokraten mit Beiträgen zwischen
fünf und mehreren hunderttausend Dollar auf eine breite Basis. So konnte
Obama fast 300 Millionen Dollar für Wahlwerbespots ausgeben, wobei etwa die
Hälfte des Betrages mithilfe tausender Kleinstspenden finanziert wurde.
„Bitte leiste Deine erste Spende jetzt", wurden Sympathisanten schnörkellos
per E-Mail gebeten und konnten gleich online Geldbeträge anweisen. „Deine
Unterstützung gibt uns den entscheidenden Schub“, lautete die Botschaft
elektronischer Bettelbriefe, die von der neuen Präsidenten-Gattin Michelle
Obama verschickt wurden.
Ideologische Plattform und
Online-Sammelbüchse
Das Internet und Barack Obama haben traditionelle Wahlkampfmethoden auf den
Kopf gestellt. Herrschten früher einfache Stimulus-Response-Modelle vor, die
später um eine gezielte Ansprache von Meinungsführern (Two Step Flow)
ergänzt wurden, schufen die US-Demokraten nun dezentrale Strukturen mit etwa
fünf Millionen politischen Streetworkern. Das World Wide Web diente über die
Plattform
 my.barackobama.com
(„MyBO“) dabei als virtuelles Verständigungsmittel und ideologische
Plattform, als Online-Sammelbüchse, Datenbank und Einsatzplan. Die
Ergebnisse von Wahlkampf-Gesprächen wurden elektronisch erfasst und mit
vorhandenen empirischen Daten kombiniert. Informationen über Geschlecht,
Alter und Wohnort, über Konsumgewohnheiten und den sozioökonomischen Status
einzelner Wähler ließen sich vom Unternehmen Strategic Telemetry für das so
genannte Microtargeting aufbereiten. Schließlich entstanden Profile über
politische Positionen einzelner Wähler, die eine individuelle
Wahlbeeinflussung erlauben sollten. my.barackobama.com
(„MyBO“) dabei als virtuelles Verständigungsmittel und ideologische
Plattform, als Online-Sammelbüchse, Datenbank und Einsatzplan. Die
Ergebnisse von Wahlkampf-Gesprächen wurden elektronisch erfasst und mit
vorhandenen empirischen Daten kombiniert. Informationen über Geschlecht,
Alter und Wohnort, über Konsumgewohnheiten und den sozioökonomischen Status
einzelner Wähler ließen sich vom Unternehmen Strategic Telemetry für das so
genannte Microtargeting aufbereiten. Schließlich entstanden Profile über
politische Positionen einzelner Wähler, die eine individuelle
Wahlbeeinflussung erlauben sollten.
Um Wähler zielgerichtet und effektiv anzusprechen, setzen inzwischen alle
amerikanischen Parteien auf die Predictive Analytics-Software des
Herstellers SPSS Inc. Diese Software ermöglicht gezielte und persönliche
Mailings, Anrufe oder Hausbesuche. Dank
ausgefeilter EDV-Programme (Voter Contact Tools) wird dabei wenig dem Zufall
überlassen, was vor allem in den so genannten Swing-Staaten mit wechselnder
Parteienpräferenz wichtig ist. Als beispielsweise in Ohio das Meinungsklima
zugunsten von Obama zu kippen begann, riefen etwa 6.500 seiner freiwilligen
Helfer in nur einer Woche mehr als 400.000 Wähler an und besuchten etwa
ebenso viele zu Hause. Noch wenige Stunden vor der Wahl klingelte bei mehr
als einer Million potenzieller Wähler das Telefon, und es meldeten sich
Obamas Unterstützer aus ihren Wahlkampfbüros mit einem fröhlichen „Yes, we
can“.
Wahlwerbung per Videoclip
Barack Obama hat wie kein anderer Politiker vor ihm das Internet als
interaktive Wahlkampfplattform eingesetzt. Die Konzerne Google und Microsoft
gehörten mit jeweils mehr als 700 Millionen Dollar zu den wichtigsten
Geldgebern des demokratischen Kandidaten. Das World Wide Web spielte aber
nicht nur zum Spendensammeln und zur Rekrutierung von aktiven
Wahlkämpfern eine zentrale Rolle im US-Wahlkampf. Egal ob bei MySpace,
YouTube, Facebook, Flickr, Twitter oder in Weblogs: Superstar Obama war
überall, sogar als Werbung auf virtuellen Plakatwänden im Online-Spiel
Burnout Paradise. Die Wahlkampf-Manager der Demokraten ließen sich von
Facebook-Mitgründer Chris Hughes beraten und setzten darauf, dass Obama-Fans
politische Werbebotschaften, die an wichtigen Knotenpunkten des
elektronischen Netzes zur Verfügung standen, in alle Richtungen weiter
verbreiteten. So mutierte der Slogan „Yes, we can“ zum omnipräsenten
kategorischen Imperativ einer Graswurzel-Kampagne. Erstmals wurde das Motto
„Spread the World“ als goldene Marketing-Regel des Web 2.0 in die Sphäre des
Politischen übertragen.
Der Begriff des Crowdsourcing erhält eine politische Dimension.
Zur effektiven Graswurzelbewegung entwickelte sich auch die bereits 1998
gegründete Initiative
 MoveOn.org,
die regelmäßig republikanische Politiker attackiert. Die linke
Lobby-Gruppierung ließ bis zum Wahltag online einen kurzen Videoclip
verschicken, in dem eine fiktionale News-Sendung den Sieg von McCain
verkündet. Ausschlaggebend seien eine Stimme und die Trägheit eines einzigen
Nichtwählers. Natürlich wurde jeweils dem Adressaten der E-Mail die Schuld
an Obamas Wahlniederlage gegeben. Auf diese Weise sollten potenzielle
Obama-Unterstützer zur Wahlurne getrieben werden. Das Ergebnis dieser
Mobilisierungskampagne: Der Link zum 1:37 Minuten langen Videoclip wurde
mehr als zwölf Millionen Mal per E-Mail verschickt, und mehr als 66 Prozent
der wahlberechtigten US-Amerikaner gaben diesmal ihre Stimme ab – ein
Rekord-Wahlbeteiligung. MoveOn.org,
die regelmäßig republikanische Politiker attackiert. Die linke
Lobby-Gruppierung ließ bis zum Wahltag online einen kurzen Videoclip
verschicken, in dem eine fiktionale News-Sendung den Sieg von McCain
verkündet. Ausschlaggebend seien eine Stimme und die Trägheit eines einzigen
Nichtwählers. Natürlich wurde jeweils dem Adressaten der E-Mail die Schuld
an Obamas Wahlniederlage gegeben. Auf diese Weise sollten potenzielle
Obama-Unterstützer zur Wahlurne getrieben werden. Das Ergebnis dieser
Mobilisierungskampagne: Der Link zum 1:37 Minuten langen Videoclip wurde
mehr als zwölf Millionen Mal per E-Mail verschickt, und mehr als 66 Prozent
der wahlberechtigten US-Amerikaner gaben diesmal ihre Stimme ab – ein
Rekord-Wahlbeteiligung.
Online-Opposition gegen das Politainment
Dass die klassischen Massenmedien – vor allem Zeitungen und Zeitschriften –
im US-Wahlkampf an Glaubwürdigkeit und damit auch an Bedeutung verloren,
liegt auch daran, dass Blätter wie die Washington Post oder die New York
Times während des Irak-Krieges professionellen Journalismus durch
Patriotismus ersetzten. Schon damals entwickelten sich kontroverse
politische Diskussionen zunächst in den Communities und Weblogs des
Internet. Dort wurden auch im Kampf um das Präsidentenamt viele
publizistische Akzente gesetzt. Online-Publikationen wie die liberale
 Huffington
Post, Huffington
Post,
 Politico,
der konservative Politico,
der konservative
 Drudge
Report
oder Drudge
Report
oder
 Daily
Kos
verbreiten zwar vor allem Gerüchte und subjektive Einschätzungen, haben aber
trotzdem entscheidend zur Repolitisierung zahlreicher ehemals wahlmüder
Amerikaner beigetragen. Blogger gelten als meinungsfreudig, Online-Portale
als schnelle Kommunikationsmittel und Communities als basisnah. Kaum eine
Aktion der Spitzenkandidaten blieb deshalb bei der Präsidentschaftswahl
unbeobachtet oder unkommentiert. So wurden Legenden wie die, dass Hillary
Clinton in Sarajevo von Scharfschützen bedroht worden sei, rasch entzaubert
und stellten die Glaubwürdigkeit einzelner Akteure in Frage. Daily
Kos
verbreiten zwar vor allem Gerüchte und subjektive Einschätzungen, haben aber
trotzdem entscheidend zur Repolitisierung zahlreicher ehemals wahlmüder
Amerikaner beigetragen. Blogger gelten als meinungsfreudig, Online-Portale
als schnelle Kommunikationsmittel und Communities als basisnah. Kaum eine
Aktion der Spitzenkandidaten blieb deshalb bei der Präsidentschaftswahl
unbeobachtet oder unkommentiert. So wurden Legenden wie die, dass Hillary
Clinton in Sarajevo von Scharfschützen bedroht worden sei, rasch entzaubert
und stellten die Glaubwürdigkeit einzelner Akteure in Frage.
Wie groß der Einfluss von Online-Medien auf den Wahlkampf sein kann, wurde
beim (tiefen) Fall der Sarah Palin deutlich: Der konservative, 21-jährige
Blogger Adam Brickley hatte die Gouverneurin von Alaska in seinem Weblog ( palinforvp.blogspot)
als Stellvertreterin McCains ins Spiel gebracht. Die Idee wurde schließlich
vom Weekly Standard aufgegriffen und populär gemacht. Nach zahlreichen
ungeschickten Auftritten der Ex-Schönheitskönigin tauchten bei YouTube jede
Menge Parodien auf, und bei Facebook formierten sich Gegner als
Anti-Palin-Gruppen. Was als Überraschungs-Coup geplant war, endete für
McCain als Gefahr fürs eigene Image. Als die Komikerin Tina Fey in der
NBC-Show Saturday Night Live Palin regelmäßig zum Satire-Opfer machte,
scheiterte das Politainment-Konzept der Republikaner an einer gefährlichen
Mischung aus Online-Opposition und TV-Comedy. palinforvp.blogspot)
als Stellvertreterin McCains ins Spiel gebracht. Die Idee wurde schließlich
vom Weekly Standard aufgegriffen und populär gemacht. Nach zahlreichen
ungeschickten Auftritten der Ex-Schönheitskönigin tauchten bei YouTube jede
Menge Parodien auf, und bei Facebook formierten sich Gegner als
Anti-Palin-Gruppen. Was als Überraschungs-Coup geplant war, endete für
McCain als Gefahr fürs eigene Image. Als die Komikerin Tina Fey in der
NBC-Show Saturday Night Live Palin regelmäßig zum Satire-Opfer machte,
scheiterte das Politainment-Konzept der Republikaner an einer gefährlichen
Mischung aus Online-Opposition und TV-Comedy.
Leitmedium Fernsehen verliert an
Bedeutung
Beim Herstellen von Öffentlichkeit für eine symbolische Politik und beim
Etablieren von Themen (Agenda Setting) spielt bei Wahlkämpfen das Fernsehen
zwar noch immer eine zentrale Rolle. Doch auch bei solchen Prozessen, in
denen es vor allem um das Erregen von Aufmerksamkeit geht, wird das Internet
zur Gefahr für das Leitmedium Fernsehen. So nutzten etwa sowohl bei den
Demokraten als auch bei den Republikanern die Kandidaten für den
Vorwahlkampf nicht etwa das Fernsehen, sondern das Videoportal YouTube, um
ihre Kandidatur zu erklären.
Web-TV und Videoportale bieten Möglichkeiten, Communities zu initiieren oder
audiovisuelle Berichterstattung um Meinungs- und Diskussionsbeiträge zu
ergänzen. Um solche intermedialen Effekte zu optimieren, gründete der
Medienkonzern Time Warner im vergangenen Jahr sein Online-Angebot
 The
Page. Der umsatzstärkste Medienkonzern der
Welt
reicherte mit dem Blog sein Produktportfolio im politischen
News-Bereich
an. Nun können Themen von Time Magazine und CNN online aufgegriffen
und ergänzt werden, was im Wahlkampf eine Berichterstattung rund um die Uhr
ermöglichte. The Page
versteht sich als „one stop-shopping site for everything that is important
in the political world“. Der kluge Kopf hinter dem
Konzept ist Mark Halperin. Der ehemalige ABC-Fernsehmann schrieb unter
anderem das Buch „The Undecided Voter’s Guide to the Next President“. The
Page. Der umsatzstärkste Medienkonzern der
Welt
reicherte mit dem Blog sein Produktportfolio im politischen
News-Bereich
an. Nun können Themen von Time Magazine und CNN online aufgegriffen
und ergänzt werden, was im Wahlkampf eine Berichterstattung rund um die Uhr
ermöglichte. The Page
versteht sich als „one stop-shopping site for everything that is important
in the political world“. Der kluge Kopf hinter dem
Konzept ist Mark Halperin. Der ehemalige ABC-Fernsehmann schrieb unter
anderem das Buch „The Undecided Voter’s Guide to the Next President“.
Personalisierung und Emotionen
statt nüchterner Debatten
Noch während Barack Obama beim Nominierungsparteitag
in Denver sein politisches Programm präsentierte, begannen Blogger echte und
wenige echte News zu kommentieren und zu kolportieren. Das World Wide Web
mag bei der politischen Kommunikation einen Paradigmenwechsel zugunsten
partizipativ positiver Effekte einleiten. Eines aber hat sich im
amerikanischen Wahlkampf auch im Online-Zeitalter nicht geändert:
Personalisierung und Emotionalisierung verdrängten sachliche Debatten und
harte Fakten. So blieben McCain und Obama den Wählern viele Antworten
schuldig. Ihre Positionen im Irak-Konflikt wirkten ebenso schemenhaft wie
Fragen der Gesundheits- und Energiepolitik. Im Mittelpunkt vieler
Medienberichte standen nicht etwa sachpolitische Themen, sondern vor allem
Fragen nach der Professionalität, der Glaubwürdigkeit und nach den
Strategien der Kontrahenten in der politischen Arena. Kritische Analysen wie
die des Online-Magazins
 Salon.com
fanden sich selten. Um so mehr ging es um die telegene Inszenierung von
Politik, was vor allem Obama zu nutzen verstand. Geschickt spielte er die
Rolle des bescheidenen Superstars, der vor laufenden Kameras nur selten
Aussetzer hatte, während McCain immer wieder mit den Tücken von
Teleobjektiven und Telepromptern zu kämpfen hatte. Salon.com
fanden sich selten. Um so mehr ging es um die telegene Inszenierung von
Politik, was vor allem Obama zu nutzen verstand. Geschickt spielte er die
Rolle des bescheidenen Superstars, der vor laufenden Kameras nur selten
Aussetzer hatte, während McCain immer wieder mit den Tücken von
Teleobjektiven und Telepromptern zu kämpfen hatte.
Obamas erfolgreiche Kampagne fasziniert angesichts des bevorstehenden
Superwahljahres 2009 inzwischen auch deutsche Politiker. Christoph Matschie,
SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, reiste eigens in die
USA, um sich vor Ort Eindrücke zu verschaffen. Er beobachtete Wahlhelfer in
New Hampshire und zeigte sich fasziniert, dass es Obama gelang, nicht nur
Parteimitglieder für den Kampf um die Wählergunst zu mobilisieren. Bereits
Ende August waren SPD-Generalsekretär Hubertus Heil,
CDU-Verteidigungsexperte Karl A. Lamers und Reinhard Bütikofer, Parteichef
von Bündnis 90/Die Grünen, zum Nominierungs-Parteitag der Demokraten in
Denver geflogen. Der CDU-Bundesgeschäftsführer
Klaus Schüler schaute sich sowohl Obamas Nominierung als auch die des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers
John McCain aus nächster Nähe an.
Amerikanisierung im deutschen Superwahljahr?
2009 stehen Europawahl, Bundestagswahl und Bundespräsidenten-wahl sowie acht
Kommunalwahlen (unter anderem in Nordrhein-Westfalen) und vier
Landtagswahlen (in Brandenburg, im Saarland, in Sachsen und in Thüringen)
an. Noch aber sind deutsche Politiker trotz aller Wahlkampf-Amerikanisierung
weit von Obamas digitaler Kampagne entfernt. So erinnert der
 Video-Podcast
von Bundeskanzlerin Angela Merkel
eher an eine klassische Fernsehansprache.
Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Kurt Beck experimentierte mit einer
Serie bei YouTube ( Video-Podcast
von Bundeskanzlerin Angela Merkel
eher an eine klassische Fernsehansprache.
Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Kurt Beck experimentierte mit einer
Serie bei YouTube ( Ihre
Frage an Kurt Beck) und scheiterte: Die
erste Folge wurde nur etwa 14.000 Mal abgerufen und die Reihe schnell wieder
eingestellt. Ihre
Frage an Kurt Beck) und scheiterte: Die
erste Folge wurde nur etwa 14.000 Mal abgerufen und die Reihe schnell wieder
eingestellt.
Der CDU-Kanal bei YouTube ( de.youtube.com/cdutv)
wies Ende November nur knapp 200 Abonnenten auf, das SPD-Pendant ( de.youtube.com/cdutv)
wies Ende November nur knapp 200 Abonnenten auf, das SPD-Pendant ( de.youtube.com/spdvision)
fast 500. Zum Vergleich: Obamas Musikclip „Yes we can“ erzielte mehr als 17
Millionen YouTube-Abrufe. Noch benutzen deutsche Politiker das Internet
lediglich als Distributionsweg für traditionelle Wahlkampf-Inhalte wie
Reden, Pressemitteilungen oder Autogrammkarten – aber fast immer ohne
interaktive Angebote, ohne originelle Ideen und ohne eine Einbindung der
Nutzer und potenziellen Wähler. Dabei werden von der Politik zunächst die
klassischen Medien bedient, und das Internet dient als Kanal für die
Wiederholung bereits vorhandener Botschaften. de.youtube.com/spdvision)
fast 500. Zum Vergleich: Obamas Musikclip „Yes we can“ erzielte mehr als 17
Millionen YouTube-Abrufe. Noch benutzen deutsche Politiker das Internet
lediglich als Distributionsweg für traditionelle Wahlkampf-Inhalte wie
Reden, Pressemitteilungen oder Autogrammkarten – aber fast immer ohne
interaktive Angebote, ohne originelle Ideen und ohne eine Einbindung der
Nutzer und potenziellen Wähler. Dabei werden von der Politik zunächst die
klassischen Medien bedient, und das Internet dient als Kanal für die
Wiederholung bereits vorhandener Botschaften.
„Die Parteien glauben immer noch mehr an die Botschaftskontrolle und
fürchten sich davor, dass andere eigene Slogans für ihre Kampagne basteln.
Ein Kommunikationsverlauf, der bottom-up und nicht top-down verläuft, ist
für viele weiterhin ein Horror“, sagte Politikberaterin Kerstin Phlewe,
Vorsitzende des Deutschen Dialogmarketing-Verbandes, im Interview mit der
Fachzeitschrift Horizont. Der Online-Dialog mit dem Wähler bleibt in
Deutschland deshalb die Ausnahme. Ganz anders in den USA: Dort schrieb
Barack Obama gleich nach seiner Wahl zum 44. US-Präsidenten eine
Online-Botschaft via MySpace: „Wir haben gerade Geschichte gemacht", teilte
er Sympathisanten und Wählern mit. „Und ich will, dass Ihr nicht vergesst,
wie wir das geschafft haben. Ihr habt an jedem einzelnen Tag in diesem Wahlkampf Geschichte gemacht – jeden Tag, den Ihr
an Türen geklopft, eine Spende gegeben oder mit Freunden, Nachbarn
gesprochen habt. All dies ist wegen Euch passiert. Danke. Euer Barack." Erst
nach dem Formulieren dieser Botschaft ging Obama hinaus, um sich im Grant
Park von Chicago feiern zu lassen. |