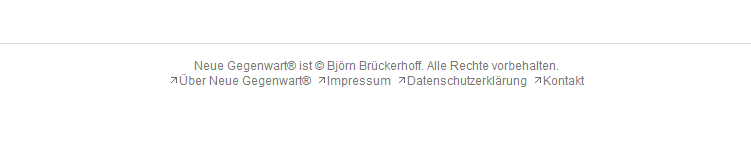|

FERNSEHLANDSCHAFT
Hybridformate
sind Trumpf
TEXT:
 STEPHAN
LENHARDT STEPHAN
LENHARDT
BILD: PHOTOCASE.DE
Thomas Gottschalk
ist in Deutschlands größter Boulevardzeitung am
Krankenbett Küblböcks zu bewundern. Mit den besten Genesungswünschen. Das
Krankenbett, glaubt man der Berichterstattung eben jener Zeitung, war in den
ersten Wochen wohl eher ein Sterbebett, so dramatisch schien Küblböcks
Zustand seit dem Gurkenlaster-Unfall. Die Wahrheit war nicht ganz so dramatisch.
Übrigens echauffierte sich
eben jener Thomas Gottschalk
laut Jahrbuch Fernsehen 2003, dass die Zlatkos
und Küblböcks die
tradierten Formen der Fernsehunterhaltung beiseite rüpelten. „Die Figuren,
die sie aus mir oder auch aus Günther [Jauch] – ich glaube, der ist der
Letzte – gemacht haben, wird es so nicht mehr geben. Es gab ja keine
Alternative zu uns“, sagte er da. Und nun steht er warm lächelnd im kalten
Krankenzimmer. Fast scheint es so, als ob Küblböck im Land des größten
europäischen Fernsehmarktes Narrenfreiheit genösse, wie sie sonst nur dem
Fußballkaiser Beckenbauer zuteil wird. Im Ranking eines Privatsenders zu den
Hundert nervigsten Deutschen erreichte Küblböck unangefochten
 Platz
Nummer Eins. Platz
Nummer Eins.
Hybridformate
auf dem
Vormarsch
Wie konnte es soweit kommen? Wer ist eigentlich dieser
Daniel Küblböck? Politiker, Spitzensportler, Musiker? Nichts dergleichen.
Küblböck ist ein Kind der Medien. Ein Produkt der so genannten „neuen“
Programmformate. Bekannt wurde er durch die Sendung „Deutschland sucht den
Superstar“, die die „untalentierte, aber irgendwie originelle
Gesangsschwuchtel“ (Jahrbuch Fernsehen 2003) nicht einmal gewann und dennoch
weitaus populärer wurde, als beispielsweise der etwas
farblose Gewinner Alexander Klaws.
Doch was heißt eigentlich „neue“
Programmformate? Denn richtig viele Neuigkeiten gibt
es seit 2000, der Geburtsstunde von
 „Big
Brother (BB)“, nicht mehr.
Weder in „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“ und
schon gar nicht bei der Sendung mit dem einprägsamen Titel „Ich bin
ein Star. Holt mich hier raus!“.
Und auch die Idee, Menschen
mit versteckten Kameras zu filmen, ist ein alter Hut („Verstehen sie Spaß“,
„Vorsicht Kamera“ und so weiter). „Big
Brother (BB)“, nicht mehr.
Weder in „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“ und
schon gar nicht bei der Sendung mit dem einprägsamen Titel „Ich bin
ein Star. Holt mich hier raus!“.
Und auch die Idee, Menschen
mit versteckten Kameras zu filmen, ist ein alter Hut („Verstehen sie Spaß“,
„Vorsicht Kamera“ und so weiter).
Es gibt also seit geraumer Zeit nichts
„Neues“ mehr. Vielmehr ist eine Wiederkehr bewährter Programmformate in
neuer Mischung derzeit Trumpf bei der Programmplanung der Sendeanstalten.
Hybridformate nennt dies die Medienforschung.
Internationale Erfolgsgaranten
Betrachtet man die Entstehungsgeschichten der
Sendungen, kann aus deutscher Sicht von Neuheiten nicht mehr
gesprochen werden. Big Brother ist eine Erfindung des Holländers John de Mol und lief
im Nachbarland bereits vor dem Deutschland-Start. DSDS, ein Konzept des
britischen Musikmanagers Simon Fuller, startete in Großbritannien als
 „Pop
Idol“ ebenfalls vor
der Deutschland-Premiere. Und „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ (an dem die britische Produktionsfirma Granada verdiente) lief
tatsächlich auch unter dem Titel „Pop
Idol“ ebenfalls vor
der Deutschland-Premiere. Und „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ (an dem die britische Produktionsfirma Granada verdiente) lief
tatsächlich auch unter dem Titel
 „I´m a celebrity, get me out of here!"
in Großbritannien. Kaum hatten diese das Dschungel-Camp
verlassen, übernahmen die Deutschen die Regie im wilden australischen Outback. Bloß in dem Teil, in dem das Studio steht, ging es weniger wild zu:
Der Großteil der Produktionsstätte war überdacht, der Badetümpel künstlich
angelegt und die Tiere von der Produktionsfirma ausgesetzt. „I´m a celebrity, get me out of here!"
in Großbritannien. Kaum hatten diese das Dschungel-Camp
verlassen, übernahmen die Deutschen die Regie im wilden australischen Outback. Bloß in dem Teil, in dem das Studio steht, ging es weniger wild zu:
Der Großteil der Produktionsstätte war überdacht, der Badetümpel künstlich
angelegt und die Tiere von der Produktionsfirma ausgesetzt.
Bemerkenswert auch die Vermarktungsstrategien
des Bertelsmann-Konzerns, in dessen Sendern (RTL-Gruppe) alle drei Produkte
zu betrachten waren. Bestes Beispiel ist hier DSDS. Die MMC-Studios (RTL-Group-Beteiligung:
25,16 %) verkauften die Karten für die Shows im Kölner Coloneum für einen
Preis von 25 Euro. Die Bertelsmann-Tochtergesellschaft Medienfabrik GmbH
gibt ein Fan-Magazin heraus. Auf Vox gab es zur zweiten Staffel eine
Magazinsendung. Beispiele lassen sich wohl noch einige finden.
Genauso beeindruckend ist natürlich auch der Erfolg der neuen Hybridformate.
Die erste Staffel „Big Brother“ erreichte vor allem beim jüngeren Publikum
(14-29jährige) einen Marktanteil von 30 bis 40 Prozent. Den Höhepunkt in der
Zuschauergunst erlangte „Ich bin ein Star...“ am 13. Januar
2004 mit 33,3 Prozent innerhalb
der oben beschriebenen werberelevanten Zielgruppe. Dementsprechend hoch
waren die Werbeeinnahmen. Ein 30sekündiger Werbespot kostete bei „Ich bin ein
Star..."
bis zu 34.500 Euro. Hinzu kommen bei allen Sendungen die Einnahmen durch die
Telefonanrufe der Zuschauer. Die genaue Höhe bleibt freilich unter
Verschluss.
Während bei Big Brother die Kandidaten von Sendung zu
Sendung hinausgewählt wurden, wird
bei DSDS nur noch der Beste unter den Guten gesucht. Die Kandidaten wurden
nicht hinausgewählt, sondern hinein - ins Finale. Als klar wurde, dass der Reiz der Schadenfreude, der
sicherlich nicht einen geringen Anteil der Zuschauer an den Bildschirm
fesselte, nur noch bedingt vorhanden war, wurde in „Ich bin ein Star...“
die perfekte Symbiose geschaffen. Mittels Telefonanruf wurde bestimmt, wer
mehr oder minder appetitliche Prüfungen vor der Kamera bestehen musste. Zum
Glück hatte Küblböck einen festen Fan-Kreis, der ihn immer wieder in Aktion
sehen wollte.
Privates,
Intimes und Alltägliches
„Ein attraktives Angebot für spezifische
Zielgruppen bleiben Unterhaltungssendungen, die in der ein oder anderen
Weise die Realität widerspiegeln bzw. zumindest vorgeben, sie
wiederzuspiegeln. Fakt ist, dass sich mit den kommerziellen Sendern
Privates, Intimes und Alltägliches ihren Weg auf den Bildschirm gebahnt
haben“, schrieb der Medienpädagoge
 Uli Gleich bereits vor drei Jahren. Die mittlerweile fünfte Staffel von Big
Brother gibt ihm
Recht. Die fehlende Authentizität, an der
Big Brother zwischenzeitlich
krankte, wird nun durch sexuelle Aktivität seitens der Kandidaten
ausgeglichen. Ein Szenario, bei dem die bewegte Bettdecke aus der ersten
Staffel eher wie eine nackte Brust beim Super Bowl daherkommt. Uli Gleich bereits vor drei Jahren. Die mittlerweile fünfte Staffel von Big
Brother gibt ihm
Recht. Die fehlende Authentizität, an der
Big Brother zwischenzeitlich
krankte, wird nun durch sexuelle Aktivität seitens der Kandidaten
ausgeglichen. Ein Szenario, bei dem die bewegte Bettdecke aus der ersten
Staffel eher wie eine nackte Brust beim Super Bowl daherkommt.
Pig Brother?
Was bringt die Zukunft?
 „Simple
Life“
heißt die neueste Sendung auf Pro Sieben, in der die Berufs-Erbin Paris
Hilton das harte Dasein auf dem Bauernhof überstehen muss. Und auch den
Hörfunk scheint das normale Leben mittlerweile eingeholt zu haben. Der
Rheinland-Pfälzische Sender Big FM sendet den „Simple
Life“
heißt die neueste Sendung auf Pro Sieben, in der die Berufs-Erbin Paris
Hilton das harte Dasein auf dem Bauernhof überstehen muss. Und auch den
Hörfunk scheint das normale Leben mittlerweile eingeholt zu haben. Der
Rheinland-Pfälzische Sender Big FM sendet den
 „Lügendetektor“,
bei dem Hörer Fragen über ihr Privatleben beantworten. „Lügendetektor“,
bei dem Hörer Fragen über ihr Privatleben beantworten.
 „Pig
Brother“
heißt die Antwort auf
versaute RTL 2-Fernsehbilder. Hier kann man sich ganz ungeniert in das
Privatleben einer Schwarzwildfamilie einklinken. Per Mausklick,
garantiert
jugendfrei. „Pig
Brother“
heißt die Antwort auf
versaute RTL 2-Fernsehbilder. Hier kann man sich ganz ungeniert in das
Privatleben einer Schwarzwildfamilie einklinken. Per Mausklick,
garantiert
jugendfrei.
 ZUM
SEITENANFANG ZUM
SEITENANFANG
|
AUSGABE 37
SCHWERPUNKT DAS ÖFFENTLICHE PRIVATE

STARTSEITE
EDITORIAL VON BJÖRN
BRÜCKERHOFF
INTERVIEW MIT JENS O.
BRELLE
MOMA IN BERLIN
DIE KULISSENSCHIEBER
FÜNF FRAGEN - ZEHN
ANTWORTEN
DIE BEWEGTE NATION
DARF DIE KUNST ALLES?
MAMA IST DOCH DIE BESTE
DIE EWIGE WIEDERHOLUNG
HYBRIDFORMATE SIND TRUMPF
RÜCKSICHT BEIM TELEFONIEREN
EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT
NUR BARES IST WAHRES
ALLE AUSGABEN IM ARCHIV
DAS REGISTER
ÜBER DIE GEGENWART
IMPRESSUM


 |