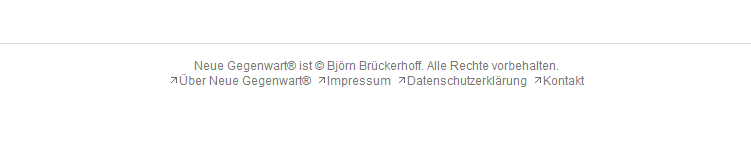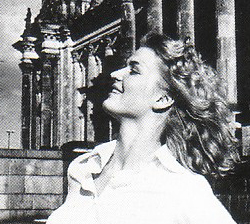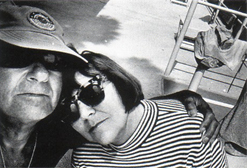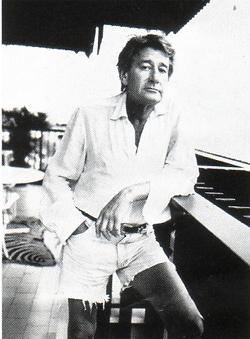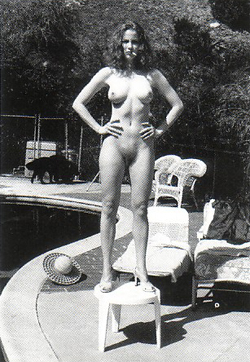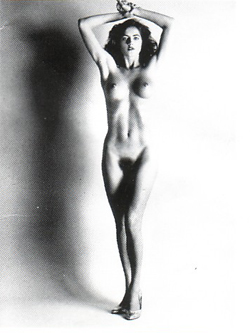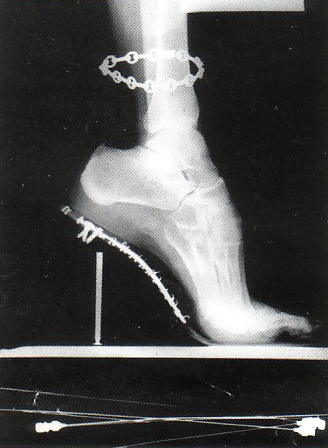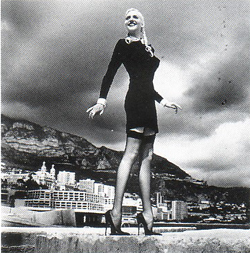|
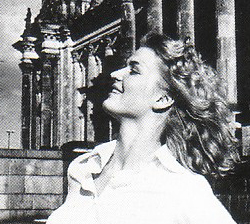
DIE AUSSTELLUNG HELMUT NEWTON - WORK
Propagandamaterial für den Geschlechterkrieg?
TEXT:
 MARC LAUTERFELD MARC LAUTERFELD
BILDER: HELMUT NEWTON
Bilder vermögen es besser und nachhaltiger als Worte, die
Wahrnehmung der Realität zu beeinflussen. Dieser Einsicht folgte schon das
alttestamentarische Bildverbot. Denn Bilder transportieren Botschaften und
wecken Emotionen. Und in der modernen Mediengesellschaft wächst die
Abhängigkeit von rein visueller Wahrnehmung. Strategisch wird dies zum
Beispiel dadurch genutzt, das
 „Embedded
Correspondents“
Bilder von der eigenen Truppe im High-Tech-Krieg produzieren, um diesen
emotional erfahrbar und dadurch menschlich erscheinen zu lassen. Aber nicht
nur im letzten Golf-Krieg, auch im Geschlechterkampf wird die
Auseinandersetzung über Bilder und deren Interpretation geführt. Als „Propagandamaterial
für den Geschlechterkrieg“
empfand
die Publizistin „Embedded
Correspondents“
Bilder von der eigenen Truppe im High-Tech-Krieg produzieren, um diesen
emotional erfahrbar und dadurch menschlich erscheinen zu lassen. Aber nicht
nur im letzten Golf-Krieg, auch im Geschlechterkampf wird die
Auseinandersetzung über Bilder und deren Interpretation geführt. Als „Propagandamaterial
für den Geschlechterkrieg“
empfand
die Publizistin
 Alice Schwarzer
(Emma 6/1993) die Fotos von Helmut Newton und begleitete fortan kritisch-polemisch sein Werk – frei nach dem Motto
„Propaganda erzeugt Gegenpropaganda“. Alice Schwarzer
(Emma 6/1993) die Fotos von Helmut Newton und begleitete fortan kritisch-polemisch sein Werk – frei nach dem Motto
„Propaganda erzeugt Gegenpropaganda“.
Die Ausstellung Helmut Newton – Work
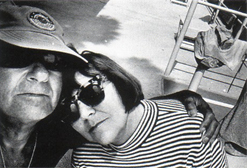
Eine umfangreiche
Retrospektive seines Schaffens, die Ausstellung „Helmut Newton – Work”, wird
bis zum 7. September im
 NRW-Forum
Kultur und Wirtschaft in Düsseldorf gezeigt. Sie bietet einen
Überblick mit mehr als 200 Arbeiten aus vier Jahrzehnten. Zu sehen sind die
„Big Nudes”, seine Portraits, die „Fashions” und „Dummies” sowie seine „X-Rays”.
Die Ausstellung wurde zu Newtons 80. Geburtstag im Jahre 2000 von seiner
Frau June kuratiert. NRW-Forum
Kultur und Wirtschaft in Düsseldorf gezeigt. Sie bietet einen
Überblick mit mehr als 200 Arbeiten aus vier Jahrzehnten. Zu sehen sind die
„Big Nudes”, seine Portraits, die „Fashions” und „Dummies” sowie seine „X-Rays”.
Die Ausstellung wurde zu Newtons 80. Geburtstag im Jahre 2000 von seiner
Frau June kuratiert.

Wohl kaum ein anderer Fotograf hat ein derart innovatives und umstrittenes
Werk geschaffen wie Helmut Newton. Dies wird bereits im Eingangsbereich des
NRW-Forums deutlich: Dort hängt das Bild „Saddle I“ – eine Frau in
Pferdepose auf einem Bett. Die am Oberkörper nur mit einem BH bekleidete
Reiterin trägt auf dem Rücken einen Sattel. Einerseits eine erzählte
Geschichte – stimmig inszeniert bis ins letzte Detail, andererseits eine bildgewordene Männerphantasie, die Widerspruch hervorruft. Einige Räume
weiter trifft man auf das Bild „Eva mit Pickelhaube“: Eine unbekleidete Frau
mit einer tief ins Gesicht gezogenen Pickelhaube und einem nietenbesetzten
Armschutz sitzt lasziv auf einem ledernen „Chefsessel“ und kontrolliert den
Sitz ihres Nietenarms. Das befremdliche des Aktes liegt in der Divergenz der
Aussagen: Die erotische Ausstrahlung der selbstbewussten Frau wird
kontrastiert mit dem militanten Biedersinn von Nietenschutz und Pickelhaube.

Propaganda oder Gegenpropaganda?
Propaganda
für den Geschlechterkampf? Oder vermeintliche Gegenpropaganda als die
eigentliche Kampagne? Bereits 1978 verklagte Alice Schwarzer den
 Stern
wegen der Veröffentlichung eines Newton-Fotos.
Die Klageschrift besagte, dass nicht nur die Art und
Weise der Darstellung, sondern auch ihre Summierung darauf hindeute, dass
System dahinter stecke: Frauendarstellungen als
Machtinstrument. Schwarzer war der Ansicht, eine globale, männliche
Verschwörung, beruhend auf einem „Gentleman's
Agreement“, Frauen nicht als
Handelnde, sondern als Objekte männlicher Kunst zu zeigen, dechiffriert zu
haben. Und Newton sei der Anführer und Schrittmacher dieses Geheimbundes,
denn wenige seien zugleich so begabt und so kalt wie er. Stern
wegen der Veröffentlichung eines Newton-Fotos.
Die Klageschrift besagte, dass nicht nur die Art und
Weise der Darstellung, sondern auch ihre Summierung darauf hindeute, dass
System dahinter stecke: Frauendarstellungen als
Machtinstrument. Schwarzer war der Ansicht, eine globale, männliche
Verschwörung, beruhend auf einem „Gentleman's
Agreement“, Frauen nicht als
Handelnde, sondern als Objekte männlicher Kunst zu zeigen, dechiffriert zu
haben. Und Newton sei der Anführer und Schrittmacher dieses Geheimbundes,
denn wenige seien zugleich so begabt und so kalt wie er.
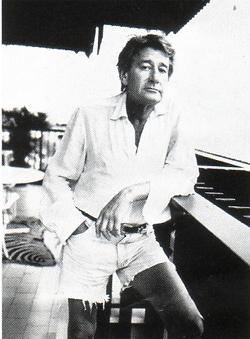
Dabei begann bereits Newtons
Adoleszenz nicht mit einer Verschwörung, sondern mit deren krassem
Gegenteil: mit einer Flucht aus Europa, bei der er völlig auf sich allein
gestellt war.
1920 in
Berlin geboren, wanderte er 1938 über Singapur nach Australien aus, wo er
als Fotograf arbeitete. Mitte der 50er Jahre kehrte er nach Europa zurück.
Alice
Schwarzer
hielt
ihm ob dieser Biographie vor,
als Mann und Jude
potentieller Täter und potentielles Opfer zugleich zu sein – und er habe
sich auf die Täterseite geschlagen. Denn keines seiner Bilder, so stellte
sie apodiktisch fest, sei das Produkt eines Besessenen, der einen
gemarterten Blick in die eigenen Abgründe wage. Newtons
Bilder beunruhigten nicht, sie bestätigten die bestehenden Verhältnisse.
Statt produktiver Fragen gäben sie glatte Antworten – pure Pornographie
also.
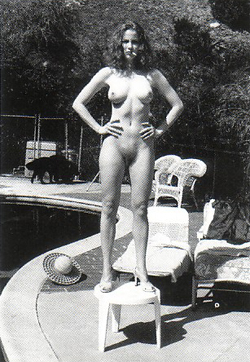
Die
äußerst kontroverse Realisierung von Mode, Akt und Portrait
ist allerdings von einer pornographischen
Bestätigung der bestehenden Verhältnisse, von glatten Antworten, weit
entfernt. In den Maßstäben einer kleinrheinischen Krämerseele mindestens so
weit, wie der Kölner Dom vom Ehrenhof, dem Ausstellungsort in Düsseldorf.
Denn
Newton geht es nicht um oberflächliche
Propaganda für den Geschlechterkampf oder schlichte Objektivierung von
Frauen. Er hat eine aufgeklärte Stilisierung, die Entnaturalisierung des
Augenblicks im Blick. Als Antwort auf die
nationalsozialistische Zurück-zur-Natur-Ideologie schätzt
Newton
alles Unnatürliche. Manche seiner Aktserien
sind so sachlich und gleichbeleuchtet inszeniert wie Passbilder.
Er sucht hierdurch den
künstlerischen Zugang zur menschlichen
Identität zu finden. Lebensgroße
Fahndungsfotos in der Polizeizentrale zur RAF-Bekämpfung regten ihn einst zu
diesen Arrangements an. Dass die Identität eines
Menschen nicht nur im Gesicht, sondern auch in seinem Körper liegt, ist
zugleich Newtons Antwort auf eine Ideologie, die Menschen als anonymes
Körpermaterial zu Abertausenden in den Tod schickte
(Ingeborg Harms,  Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, 6. Juli 2003). Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, 6. Juli 2003).
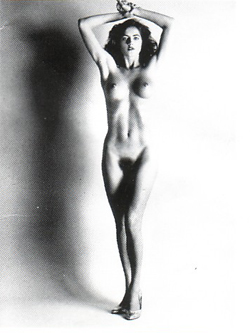
Seine monumentalen Aktaufnahmen, mit denen er
seit den 70er Jahren die heftigen feministischen Diskussionen auslöste,
vermitteln nicht das Klischee von Sexualobjekten sondern erschließen eine
Identität von starken und mächtigen Frauen. Die Ästhetik der „Big Nudes“
zeichnet sich aus durch Ironie und erzählerische Dichte, die den Betrachter
nicht bannen, sondern verführen und mit ihm kommunizieren will (Ingeborg
Harms).

1987/88 realisierte Newton die umstrittene Bauwelt-Serie von
Frauen mit Arbeitsgeräten. Sehr zum Missfallen von
Alice Schwarzer, da sein
„Rohmaterial“ auch noch ohne Gage für ihn arbeitete. In der Tat: Zum Lohn
erhielten die Modelle zumeist „nur“ ihr von Newton signiertes Foto – oder,
wie es Alice Schwarzer sah, „das signierte Abbild ihrer Erniedrigung“ (Alice
Schwarzer). Ernster und abwegiger ist in diesem Zusammenhang die Tendenz
Schwarzers, sämtliche Abbildungen als Bilder von
ermordeten Frauen zu
interpretieren. Wohl inspiriert durch die in Düsseldorf nicht gezeigte Serie
„True or False“, in der
echte, aber verzerrte Tatortfotos mit Newtons
Hochglanzinszenierungen kontrastiert werden, stellte Schwarzer ohne Bezug zum
Gesamtwerk fest, dass Newton nichts so anmache wie der erkaltete
Frauenkörper, die weibliche Leiche (Alice Schwarzer). Aber zuvor müsse sie
getötet werden. Und dazu liefere er den Stoff.

In Newtons Bildern
zeugt allerdings nichts vom schmutzigen, sinnlosen Tod
(Ingeborg Harms).
Vielmehr schärft er den Blick auf starke, gleichwohl aber
quicklebendige Frauen, in zum Teil monumentaler Pose – und immer eingebettet
in einen vitalen Erzählzusammenhang. Fatale
Leidenschaft statt Leichenkult. So war
Newton einer der Ersten, die Mode in Außenräumen und
trivialen Alltagssituationen präsentierte. Auch gelang es ihm mit den
Portraits von Schauspielern, Künstlern und Politikern dieses Thema zu
aktualisieren. In Düsseldorf sind neben
Anthony
Hopkins, Bundeskanzler Schröder und Catherine Deneuve unter anderem auch
Portraits von
Leni
Riefenstahl und
Kurt Waldheim zu sehen. Wie kaum ein anderer Fotograf vermag
er es, die Grenzen zwischen Akt, Portrait und Mode zu überschreiten und
aufzulösen. Provokativ, oft ironisch, aber auch politisch schuf er
Körperbilder von großer Intensität. Diese Portraits belegen zudem die
Entwicklung Newtons, sich mit wachsendem Alter immer mehr von den jungen,
unbeschriebenen und dadurch austauschbaren Modellen abzuwenden und das
gelebte Leben in seinen Bildern widerzuspiegeln. Ziel ist die Abbildung
echter, authentischer Identität.
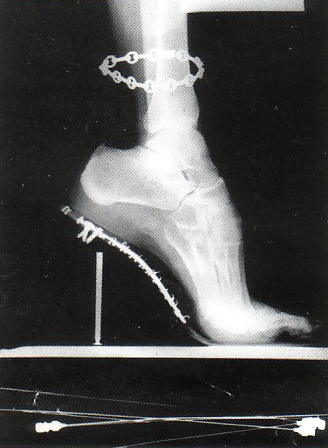
Ein Fall für Freud?
Auch ist Newton kein Fall für den Analytiker. Zwar könnte
seine Fixiertheit auf „High Heels“, die sich als roter Faden durch sein Werk
zieht und in den „X-Rays“ absurd überhöht wird, diesbezüglich als Beleg
missgedeutet werden. Da Newton aber gerade nicht bei einer vermeintlichen
Obsession stehen bleibt, sondern seine Phantasien veröffentlicht, ist,
anstatt psychoanalytische Kategorien zu bemühen, vielmehr seine
gesellschaftliche Missio zu betrachten, um sein Werk einordnen und erfassen
zu können. Das Phänomen „Newton“ sei ohne die Frauenbewegung nicht denkbar,
deutete auch Alice Schweizer diesen Gesellschaftsbezug (Alice Schwarzer). Die
zahllosen Fotoarrangements, in denen stolze Aktmodelle beanzugte Herren ganz
unverschämt mit ihrer physischen Präsenz konfrontieren, sind Manifeste des
Liberalismus
(Ingeborg
Harms).
Helmut Newton ist „zoon politikon“ – und kein Fall für Freud.
„Da hilft nur noch ein Gesetz“, mag sich Alice Schwarzer bei
soviel liberaler Gesinnung
gedacht
haben. 1987 lancierte sie mittels EMMA die Kampagne „PorNO“, die ein
Anti-Pornographie-Gesetz zum Ziel hatte – und scheiterte.
Die bekämpfte
Sexualstrafrechtsreform von 1975 sei nicht das Ergebnis von
gesellschaftlichen Umwälzungen gewesen. Vielmehr seien Forderungen nach
gleichen Rechten mit verstärkten Demütigungen beantwortet worden. In dem
EMMA-Artikel aus 1993 veröffentlichte Alice Schwarzer dann eine Analyse von
Newtons Bildern und
nutzte hierzu 19 Aktfotos ohne Genehmigung, die sie unter
anderem mit „rassistisch“ und „faschistisch“ untertitelte. Anstatt
des vergeblich erstrebten Parlamentsgesetzes nun also der Versuch, einen
„mentalen Keuschheitsgürtel“ zu etablieren. Doch auch dieser
Diskreditierungsversuch scheiterte. Newtons Werk erfährt mittlerweile nahezu
uneingeschränkte Zustimmung – und dies nicht nur in der „Post-Schwarzer-Generation“.
Der Besucherandrang in Düsseldorf ist derart groß, dass
die Ausstellung bis Anfang September verlängert wurde. Von Beginn an wurden
bereits die Öffnungszeiten der Ausstellung erweitert: Sie kann täglich
(außer Montags) bis 22:00 Uhr und Freitags sogar bis 24:00 Uhr besucht
werden.
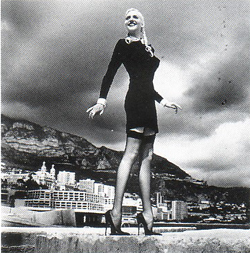
Ob die
Tugendschlachten allerdings endgültig geschlagen sind, steht freilich nicht
fest.
Gegenwind scheint aus Brüssel zu kommen: So wurden Überlegungen der
 Kommission
bekannt, die Seite-1-Modelle in Tageszeitungen zu
verbieten. Ob diese Kampagne wirklich forciert und schließlich auch die
Kunst erreichen wird, bleibt abzuwarten. Newton & Co. haben allerdings die
Freiheit auf ihrer Seite. Einem staatlichen Verbot fehlt das Mandat. Die
strittigen Darstellungen sind gelebte Freiheit von Grundrechtsträgern. Auch
aktualisiert sich keine staatliche Schutzpflicht, denn das Abbilden und das
Sich-abbilden-lassen geschieht schließlich freiwillig. Und einen Schutz vor
sich selbst, gibt es nicht im Recht. Kommission
bekannt, die Seite-1-Modelle in Tageszeitungen zu
verbieten. Ob diese Kampagne wirklich forciert und schließlich auch die
Kunst erreichen wird, bleibt abzuwarten. Newton & Co. haben allerdings die
Freiheit auf ihrer Seite. Einem staatlichen Verbot fehlt das Mandat. Die
strittigen Darstellungen sind gelebte Freiheit von Grundrechtsträgern. Auch
aktualisiert sich keine staatliche Schutzpflicht, denn das Abbilden und das
Sich-abbilden-lassen geschieht schließlich freiwillig. Und einen Schutz vor
sich selbst, gibt es nicht im Recht.
Ein Feminist im Fadenkreuz von Feministinnen?
Helmut Newton selbst beantwortete die Vorwürfe gegen sein Werk stets mit der
Feststellung: „Ich bin Feminist“. Ein Feminist im Fadenkreuz von
Feministinnen? Da hat er die Rechnung ohne seine Kritiker gemacht: Denn die
Vereinnahmung des Feminismus und die Verkehrung der Werte sei gerade ein
zentrales Element der modernen Pornographie – so sei es nur interessant,
eine starke Frau zu unterwerfen.
Dieses Dilemma aufzulösen, ist die Aufgabe der Besucher. Den verbleibenden
Monat (bis 7. September 2003) gilt es zu nutzen.
HINWEIS
Zur Ausstellung ist ein Katalog zum Preis von
Euro 29,99 erschienen.
ZUR PERSON HELMUT NEWTON
1920
Helmut Newton wird als Sohn eines Knopffabrikanten in Berlin geboren.
1936
Newton beginnt Lehre bei der Fotografin Yva, die später in Auschwitz
ermordet wurde.
1938
Newton verläßt Berlin und geht nach Singapur.
1940
Newton geht nach Australien und dient als Soldat in der australischen Armee.
1945
Nach seiner Entlassung als Soldat eröffnet Newton ein Fotostudio in
Melbourne.
1948
Newton heiratet die Schauspielerin June Brunell.
1961
Mitarbeiter der französischen Vogue; weitere Auftraggeber (Auswahl):
amerikanische/italienische/deutsche Vogue, Nova, Marie Claire und Elle.
Seit 1981
Helmut Newton lebt abwechselnd in Monte Carlo und Los Angeles.
 ZUM
SEITENANFANG ZUM
SEITENANFANG |
AUSGABE 33
SCHWERPUNKT INFOWAR

STARTSEITE
EDITORIAL VON BJÖRN BRÜCKERHOFF
INTERVIEW MIT HOWARD RHEINGOLD
WARBLOGS: AUGENZEUGENBERICHTE
ODER DESINFORMATION?
FRIEDEN AN DER
GRENZE, KRIEG IM NETZ
BAGDAD ZUR
PRIMETIME
KANONENFUTTER IM GEISTE
DAS IFG STEHT IM
KOALITIONSVERTRAG
WAS GEHEN DIE
PHILOSOPHIE COMPUTER AN?
DER DRITTE TURN DER
PHILOSOPHIE
WAR OF
EMOTIONS
PROPAGANDAMATERIAL
FÜR DEN GESCHLECHTERKRIEG?
ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG
FRIEDMAN - DÜRFEN DIE MEDIEN
RICHTEN?
POLITISCHES BRANDING
KRIEG ALS FORTSETZUNG DER PR?
NEWSLETTER
DER GEGENWART
PRESSESERVICE:
WAS IST DIE GEGENWART?
IMPRESSUM

DAS COVER DER AUSGABE 33

ALLE AUSGABEN IM ARCHIV



|