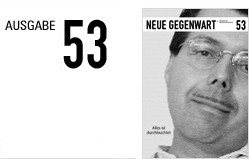|
Ab dem 1. Januar
2008 könnte Deutschland zum Überwachungsstaat werden. Die elektronische
Kommunikation der Gesellschaft soll protokolliert werden:
Telefonverbindungen, Kurzmitteilungen, E-Mails, sämtliche
Internet-einwahlvorgänge und aufgerufene Web-Adressen. Bei mobiler Kommunikation wird sogar der Standort
der Gesprächspartner festgehalten. Die Inhalte der Kommunikation bleiben
dabei zunächst unangetastet. Gespeichert werden sollen die Daten
jeweils für sechs Monate.
Die gigantische Datenmenge, die dabei entsteht, ist höchst ergiebig.
Bewegungsprofile können damit erstellt, soziale Netzwerke nachgezeichnet
werden. Wer mit wem befreundet ist, wer wann wohin reist
–
alles wird transparent.
Hintergrund der präventiven Überwachung ist die Hoffnung, über die
protokollierte Kommunikation von Millionen Bundesbürgern Erkenntnisse über
die Machenschaften von Terroristen und anderen Straftätern zu erlangen.
Polizei, Staatsanwaltschaft, Nachrichtendiensten und anderen Behörden soll der Zugriff auf
die Daten
ermöglicht werden.
Die Vorratsdatenspeicherung führt das Datenschutz-Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung ad absurdum. Dieses Recht leitet sich nach
einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1983, als erboste Bürger gegen
eine geplante Volkszählung
Verfassungsbeschwerde einreichten, direkt aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ab. Jedem Bürger wird dabei das
Recht zugesprochen, selbst festlegen zu können, welche Daten über ihn erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Berufsgruppen, für die
Verschwiegenheit besonders wichtig ist, fürchten um die Grundlagen ihrer
Arbeit: Journalisten, Ärzte, Rechtsanwälte, sogar die Kirche. Kurz: Die
Privatsphäre ist tot und alle sind verdächtig.
Neue Gegenwart hat in dieser Ausgabe mit
 Peter
Glaser über das Bewusstsein der Bevölkerung gesprochen,
persönliche Daten schützen zu müssen. Glaser ist Ehrenmitglied des Chaos Computer Clubs, Journalist
und Schriftsteller. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Entwicklungen
der Informations- und Mediengesellschaft. Peter
Glaser über das Bewusstsein der Bevölkerung gesprochen,
persönliche Daten schützen zu müssen. Glaser ist Ehrenmitglied des Chaos Computer Clubs, Journalist
und Schriftsteller. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Entwicklungen
der Informations- und Mediengesellschaft.
Schon oft war der Schutz der Privat- und Intimsphäre Thema in der Neuen
Gegenwart. Doch während noch 2004 die größte Gefahr für diese Sphären im
Fernsehen behandelt wurde
–
die Sendung
„Big
Brother“
scheint Jahrzehnte her zu sein
–
haben inzwischen
große Teile der jüngeren Bevölkerung ein sehr entspanntes Verhältnis zum
Datenschutz entwickelt. In Plattformen wie
„Facebook“
oder der deutschen Kopie
„StudiVZ“
wird freiwillig enthüllt, was die private Bildersammlung hergibt. Neue
Gegenwart-Autorin Carolin Wattenberg hat sich u. a. mit der Wirkung dieser
Freizügigkeit bei der
 Jobsuche
beschäftigt. Christian Schnorfeil ist der Frage nachgegangen, warum die
Anbieter von Jobsuche
beschäftigt. Christian Schnorfeil ist der Frage nachgegangen, warum die
Anbieter von
 Payback-Punkten
eigentlich so freundlich sind, ihre Kunden mit Prämien für Einkäufe zu
belohnen. Die Datenschutz-Expertin Christiane Schulzki-Haddouti beschäftigt
sich mit der Umsetzbarkeit der viel diskutierten Payback-Punkten
eigentlich so freundlich sind, ihre Kunden mit Prämien für Einkäufe zu
belohnen. Die Datenschutz-Expertin Christiane Schulzki-Haddouti beschäftigt
sich mit der Umsetzbarkeit der viel diskutierten
 Online-Durchsuchung
und Kristina Schneider wirft einen kritischen Blick auf Online-Durchsuchung
und Kristina Schneider wirft einen kritischen Blick auf
 People-Suchmaschinen,
die aus Netzwerkplattformen und aus den Daten von Universalsuchmaschinen
(wie z. B. Google) ungefragt Profile über jeden Web-Nutzer anlegen
–
bis dieser
widerspricht. Gibt es dort auch ein Profil von Ihnen? Die Wahrscheinlichkeit
ist hoch. People-Suchmaschinen,
die aus Netzwerkplattformen und aus den Daten von Universalsuchmaschinen
(wie z. B. Google) ungefragt Profile über jeden Web-Nutzer anlegen
–
bis dieser
widerspricht. Gibt es dort auch ein Profil von Ihnen? Die Wahrscheinlichkeit
ist hoch.
Weitere Beiträge zum Schwerpunkt finden Sie wie immer auf der aktuellen
 Startseite
der Neuen Gegenwart. Zum Beispiel zum neuen Startseite
der Neuen Gegenwart. Zum Beispiel zum neuen
 Telemediengesetz
und zu der Frage, wie Datenschutz und Datensicherheit als Themen im Telemediengesetz
und zu der Frage, wie Datenschutz und Datensicherheit als Themen im
 Qualitätsjournalismus
behandelt werden. Qualitätsjournalismus
behandelt werden.
Eine gute Lektüre wünscht Ihnen
 Björn
Brückerhoff Björn
Brückerhoff

Editorials früherer Ausgaben
|
|