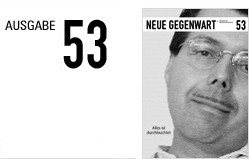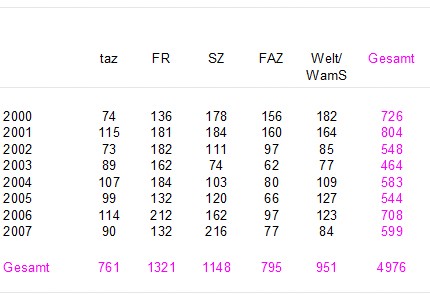|
Im öffentlichen Diskurs haben
Datenschutz-Themen derzeit Hochkonjunktur. Doch wie berichten die
Massenmedien? Eine Inhaltsanalyse überregionaler Qualitätszeitungen
ermöglicht einige Antworten – und zeigt Handlungsoptionen für die
journalistische Praxis auf.
Bis zu 15.000 Menschen strömten Ende September 2007 zum Brandenburger
Tor. Ihr gemeinsames Ziel: eine
 Großdemonstration gegen den „Überwachungswahn“ von
Politik und Wirtschaft, zu der der Großdemonstration gegen den „Überwachungswahn“ von
Politik und Wirtschaft, zu der der
 Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aufgerufen
hatte, um gegen die umstrittene Vorratsspeicherung von Telefon- und
Internetdaten, heimliche Online-Durchsuchungen oder die neue einheitliche
Steueridentifikationsnummer mobil zu machen. Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aufgerufen
hatte, um gegen die umstrittene Vorratsspeicherung von Telefon- und
Internetdaten, heimliche Online-Durchsuchungen oder die neue einheitliche
Steueridentifikationsnummer mobil zu machen.
Aktionen wie diese
zeigen: Datenschutz und Datensicherheit sind derzeit stark im öffentlichen
Diskurs präsent. Doch wie berichten die Massenmedien über diese Themen?
Lassen sich inhaltliche Präferenzen erkennen, etwa eine verstärkte
Berichterstattung im Zusammenhang mit der Terrorismus-Bekämpfung, die seit
den Anschlägen vom 11. September 2001 besonders viel Raum einzunehmen
scheint? Gibt es vernachlässigte Themenbereiche?
Um diesen
Fragen auf den Grund zu gehen, wurde mit Hilfe der Datenbank
 Genios eine Inhaltsanalyse der überregionalen
deutschen Qualitätszeitungen durchgeführt. Dazu wurden für den Zeitraum vom
1. Januar 2000 bis zum 25. Oktober 2007 die Artikel der „ Genios eine Inhaltsanalyse der überregionalen
deutschen Qualitätszeitungen durchgeführt. Dazu wurden für den Zeitraum vom
1. Januar 2000 bis zum 25. Oktober 2007 die Artikel der „ tageszeitung“
(taz), der „ tageszeitung“
(taz), der „ Frankfurter
Rundschau“ (FR), der „ Frankfurter
Rundschau“ (FR), der „ Süddeutschen
Zeitung“ (SZ), der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) und der „ Süddeutschen
Zeitung“ (SZ), der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) und der „ Welt“
(inkl. „Welt am Sonntag“) per Volltextrecherche nach den Begriffen
„Datenschutz“ und „Datensicherheit“ (OR-Verknüpfung) durchsucht und
ausgewertet. Auf diese Weise sollte geprüft werden, welche quantitativen und
qualitativen Trends sich für den Untersuchungszeitraum in der deutschen
Datenschutz-Berichterstattung nachweisen lassen. Welt“
(inkl. „Welt am Sonntag“) per Volltextrecherche nach den Begriffen
„Datenschutz“ und „Datensicherheit“ (OR-Verknüpfung) durchsucht und
ausgewertet. Auf diese Weise sollte geprüft werden, welche quantitativen und
qualitativen Trends sich für den Untersuchungszeitraum in der deutschen
Datenschutz-Berichterstattung nachweisen lassen.
Wissenschaftlichen
Qualitätskriterien genügt dieses Vorgehen sicherlich nicht. So ist (selbst-)kritisch
darauf hinzuweisen, dass die untersuchten Zeitungen teilweise nur ein
eingeschränktes Angebot ihrer Print-Beiträge in digitaler Form an Genios
übermitteln. Eine Recherche in der Datenbank ermöglicht daher nur einen
verzerrten Blick auf die tatsächliche Berichterstattung. Zudem sind die
ausgewählten Zeitungen offenkundig nur in begrenztem Maße repräsentativ für
„die Massenmedien“, d. h. für die mediale Berichterstattung insgesamt.
Nichtsdestotrotz versprach der gewählte Ansatz einige interessante
Einblicke, wenn es darum gehen sollte, den Status quo der journalistischen
Auseinandersetzung mit Datenschutz und Datensicherheit darzulegen und
mögliche Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Methodische Mängel wurden
daher aus arbeitsökonomischen Gründen in Kauf genommen.
Tabelle: Anzahl der
Beiträge zum Thema Datenschutz/Datensicherheit
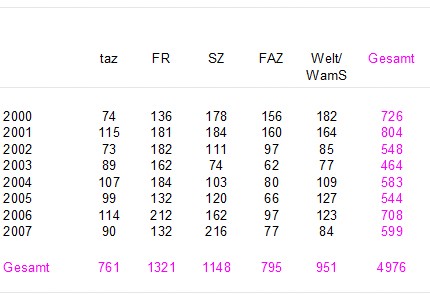
Wie die Tabelle
zeigt, konnten mit Hilfe der Genios-Recherche in taz, FR, SZ, FAZ und Welt/WamS
im Untersuchungszeitraum insgesamt 4.976 Beiträge gefunden werden, die
entweder den Begriff „Datenschutz“ oder den Begriff „Datensicherheit“
enthielten. Die meisten davon stammten aus der „Frankfurter Rundschau“
(1.321), die wenigsten aus der „tageszeitung“ (761). Insgesamt ist aber
festzuhalten, dass alle durchsuchten Zeitungen das Thema
Datenschutz/Datensicherheit in scheinbar hohem Maße thematisiert haben. Die
Abweichung der taz ist u. a. mit dem im Vergleich geringerem Umfang der
einzelnen Zeitungs-Ausgaben zu erklären.
Auch im
Zeitvergleich zeigt sich eine mehr oder minder große Kontinuität. Zwar
konnten für das Jahr 2001 mit 804 Such-Treffern insgesamt die meisten
Beiträge nachgewiesen werden, was sich wohl mit einer verstärkten
Auseinandersetzung mit dem Thema (Daten-)Sicherheit in der Folge der
Terror-Anschläge vom 11. September erklären lässt. Auch in den anderen
untersuchten Jahrgängen fand jedoch eine umfangreiche Berichterstattung zu
Datenschutz-Themen statt. Eine Initialzündung stellt der 11. September in
jedem Falle nicht dar, denn auch für das Jahr 2000 lassen sich bereits 726
entsprechende Texte finden. Die These, dass die Qualitätszeitungen im Zuge
aktueller Diskussionen um heimliche Online-Durchsuchungen und
Vorratsdatenspeicherung gegenwärtig besonders intensiv über das Thema
Datenschutz berichten, lässt sich anhand der vorliegenden Zahlen ebenfalls
nicht belegen: Für 2007 fanden sich bislang mit 599 Such-Treffern erst
vergleichsweise wenige Beiträge; allerdings dürfte dieser Wert noch steigen,
da die Berichterstattung für die letzten neuneinhalb Wochen des Jahres in
dieser Erhebung noch nicht berücksichtigt werden konnte.
Während sich im
Vergleich zwischen den untersuchten Zeitungen und im Zeitvergleich also
keine allzu erheblichen Diskontinuitäten nachweisen ließen, zeigen sich bei
der Ressortzuordnung der gefundenen Beiträge größere Abweichungen. Zwar
beschäftigten sich prinzipiell alle Ressorts der untersuchten Zeitungen auch
mit Datenschutz-Themen. Mit Abstand der größte Teil der Berichterstattung
war jedoch im Politik-Ressort verortet. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die
Qualitätszeitungen vor allem politische Entscheidungen und die
vorhergehenden und nachfolgenden Diskussionen rund um Datenschutz und
Datensicherheit verarbeiten, während andere Dimensionen des Themas
unterrepräsentiert sind.
Eine (qualitative)
Durchsicht der einzelnen Beiträge stützt diese Interpretation. So zeigt
sich, dass Aspekte des Datenschutzes im Analysezeitraum vor allem im
Zusammenhang mit dem Oberthema Verbrechensbekämpfung thematisiert wurden.
Häufig, aber längst nicht in allen Fällen geht es dabei um
datenschutzrelevante Fragen bei der Fahndung nach Angehörigen
terroristischer Vereinigungen, nicht selten auch um Chancen und Grenzen bei
der Aufklärung von Sexualverbrechen (Stichwort: DNA-Analyse) und anderer
Straftaten (Video-Überwachung, Lauschangriff, Verwendung von Maut-Daten
etc.). Ein Großteil der gefundenen Beiträge zu diesem Berichterstattungsfeld
behandelt das Thema Datenschutz nicht als zentralen Auslöser für eine
journalistische Bearbeitung. Stattdessen stehen meist aktuelle Anlässe des
politischen Tagesgeschehens (Debatte im Bundestag, Untersuchungsausschuss,
Wahlkampf etc.) im Mittelpunkt, die Journalisten aufgrund ihrer Präferenz
für Nachrichtenfaktoren wie Aktualität oder Elite-Bezug auf die Agenda
heben. Eine Auseinandersetzung mit Fragen des Datenschutzes findet dabei
oftmals nur am Rande statt, etwa durch die Einarbeitung eines entsprechenden
Zitates. Eine umfassende und hintergründige Aufbereitung des Themas ist im
Vergleich eher selten. Diese Erkenntnis relativiert das zuvor geäußerte
Zwischenfazit zum quantitativen Umfang der Datenschutz-Berichterstattung.
Unabhängig vom
Oberthema Verbrechensbekämpfung greifen die Qualitätszeitungen
Datenschutzaspekte auch in anderen thematischen Zusammenhängen auf. So wurde
in den vergangenen Jahren beispielsweise über die Diskussionen rund um die
Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und des biometrischen
Ausweises, einen möglichen Datenmissbrauch bei Kundenkarten,
Versicherten-Schutz, Vaterschaftstests, eventuelle Sicherheitslücken beim
Online-Banking u. v. m. berichtet. Im Vergleich nahmen diese Themen jedoch
einen deutlich geringeren Raum ein. Daraus lässt sich folgern, dass die
politische Dimension der Datenschutz-Berichterstattung klar im Vordergrund
steht, während andere Perspektiven – zum Beispiel die der Verbraucher, aber
auch der Arbeitnehmer – zu kurz kommen.
Diese These
lässt sich auch durch einige beispielhafte Recherchen der
zivilgesellschaftlich orientierten „ Initiative
Nachrichtenaufklärung“ (INA) belegen, die mit
ihren Listen der am meisten vernachlässigten Themen und Nachrichten in den
vergangenen Jahren immer wieder auch Datenschutz-Themen zu einer breiteren
Öffentlichkeit verhelfen wollte. So wies die INA in ihrer Initiative
Nachrichtenaufklärung“ (INA) belegen, die mit
ihren Listen der am meisten vernachlässigten Themen und Nachrichten in den
vergangenen Jahren immer wieder auch Datenschutz-Themen zu einer breiteren
Öffentlichkeit verhelfen wollte. So wies die INA in ihrer
 Top-Ten-Liste des Jahres 2006 darauf hin, dass
Unternehmen die Bonität ihrer Kunden immer häufiger anhand undurchsichtiger
Scoring-Verfahren bewerten. Die Massenmedien hatten dieses Thema komplett
vernachlässigt. Top-Ten-Liste des Jahres 2006 darauf hin, dass
Unternehmen die Bonität ihrer Kunden immer häufiger anhand undurchsichtiger
Scoring-Verfahren bewerten. Die Massenmedien hatten dieses Thema komplett
vernachlässigt.
 2004 fanden sich gleich zwei Themen zu Fragen des
Datenschutzes auf der Top-Ten-Liste: So wurde auf die mangelnde Transparenz
und Pflege vieler deutscher Kundendatenbanken und die damit verbundenen
Konsequenzen für den Verbraucher aufmerksam gemacht – ebenso wie auf die
datenschutzrelevanten Folgen der Krankenkassenreform. Beide Themen waren in
der journalistischen Berichterstattung seinerzeit kaum existent. 2004 fanden sich gleich zwei Themen zu Fragen des
Datenschutzes auf der Top-Ten-Liste: So wurde auf die mangelnde Transparenz
und Pflege vieler deutscher Kundendatenbanken und die damit verbundenen
Konsequenzen für den Verbraucher aufmerksam gemacht – ebenso wie auf die
datenschutzrelevanten Folgen der Krankenkassenreform. Beide Themen waren in
der journalistischen Berichterstattung seinerzeit kaum existent.
Aus diesen
Befunden lassen sich für die journalistische Praxis einige Empfehlungen
ableiten: Um eine mediale Berichterstattung zu gewährleisten, die sich
angemessen mit Datenschutz und Datensicherheit auseinandersetzt, ist eine
größere Unabhängigkeit von der politischen Agenda, aber auch von gängigen
journalistischen Handlungsprogrammen wie der Themenselektion anhand von
Nachrichtenfaktoren notwendig. So lässt sich erreichen, dass auch solche
Themen hintergründig bearbeitet werden, die zwar nur latent aktuell sind,
aber dennoch eine große gesellschaftliche Relevanz bergen. Auf diese Weise
dürfte sich auch der Fokus auf die politischen Akteure in der
Berichterstattung verringern lassen, während mehr Raum dafür bleibt, sich
anderen, bislang unterrepräsentierten Personengruppen – wie eben den
Verbrauchern – zuzuwenden.
Großdemonstrationen wie die des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung
zeigen, dass dieser Perspektivwechsel in den Köpfen zahlreicher Bürger
bereits stattgefunden hat. Nun wird es Zeit, dass auch die Qualitätsmedien
nachziehen.
|
Der Autor

Tobias Eberwein
Jahrgang 1978, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Journalistik der Universität Dortmund. Als Leiter der Lehrredaktion Online-
und Medienjournalismus ist er für das Internet-Magazin „ Medien
Monitor“ verantwortlich. Zudem ist als er
Chefredakteur des „ Medien
Monitor“ verantwortlich. Zudem ist als er
Chefredakteur des „ Journalistik
Journals“ und Rezensionsredakteur für die „Publizistik“
tätig. Weitere Informationen auf Journalistik
Journals“ und Rezensionsredakteur für die „Publizistik“
tätig. Weitere Informationen auf
 tobias-eberwein.de. tobias-eberwein.de.
|