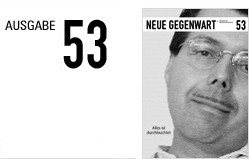|
Früher, kurz bevor das Internet zum Massenmedium wurde, konnte man alle deutschen
Telefonbücher auf einer CD-ROM erwerben. Später, in einer zweiten Fassung,
kamen zu den Namen und Nummern sogar einige statistische Informationen
hinzu. Jetzt erfuhr man zumindest die Wahrscheinlichkeit, mit der der
Gesprächspartner in einer Hütte oder in einem Palast residierte. Die Aufregung war groß.
Das ist sehr lange her. Heute kann man Satellitenfotos des eigenen Gartens in
jedem Routenplaner abrufen. Oder bei
 Google
Streetview mitunter das eigene Auto samt Kennzeichen an der Ampel
stehen sehen. Ungefragt, versteht sich. Auch wenn sich jetzt viele über die
geplante Vorratsdatenspeicherung aufregen: Datenschutz scheint heute für viele Menschen in
ihrem Alltag kaum noch eine Rolle
zu spielen. Neue Gegenwart hat mit dem Journalisten und Schriftsteller Peter
Glaser über dieses Phänomen gesprochen. Google
Streetview mitunter das eigene Auto samt Kennzeichen an der Ampel
stehen sehen. Ungefragt, versteht sich. Auch wenn sich jetzt viele über die
geplante Vorratsdatenspeicherung aufregen: Datenschutz scheint heute für viele Menschen in
ihrem Alltag kaum noch eine Rolle
zu spielen. Neue Gegenwart hat mit dem Journalisten und Schriftsteller Peter
Glaser über dieses Phänomen gesprochen.
Neue Gegenwart:
Was sind Gründe für das offenbar fehlende Problem-bewusstsein hinsichtlich
Datenschutz?
Peter Glaser:
Das Problem liegt zum Teil darin, dass einem auf den ersten Blick nichts
genommen wird. Meine Daten sind ja noch immer vollständig bei mir, auch
wenn jemand sich eine Kopie davon aneignet.
Neue Gegenwart:
Inzwischen gibt es im Alltag viel mehr Möglichkeiten, Datenspuren zu
hinterlassen. Wo sehen Sie die größten Datensammler?
Glaser:
Behörden, der Handel, die so genannten Sozialen Netzwerke, auch die modernen
Formen des klassischen Adresshandels. Und natürlich Spammer, die jede
E-Mail-Adresse absammeln, derer sie habhaft werden können.
Neue Gegenwart:
Auf Websites wie „Xing“ können Nutzer detaillierte Profile über sich selbst
anlegen, um sich virtuell zu „vernetzen“. Im Studentenportal „StudiVZ“ ist
es zusätzlich möglich, nicht nur persönliche Interessen und Studienfächer
einzugeben, sondern auch Bilder einzustellen, andere Personen auf Bildern zu
markieren und auf einer individuellen, aber öffentlichen Pinnwand in jedem
Profil Nachrichten zu hinterlassen – mit weitreichenden Folgen. In
 Personalabteilungen werden Bewerber inzwischen nicht mehr nur „gegoogelt“.
Auch Profile in sozialen Netzwerken werden überprüft. Wieso veröffentlichen
Menschen derart viele private Daten? Personalabteilungen werden Bewerber inzwischen nicht mehr nur „gegoogelt“.
Auch Profile in sozialen Netzwerken werden überprüft. Wieso veröffentlichen
Menschen derart viele private Daten?
Glaser:
Die Generation, die mit dem
„Web 2.0" aufwächst, ist noch ziemlich unbekümmert
und sieht vor allem den Kontaktspaß, den man sich dafür einhandelt. Es ist
noch zu wenig Zeit vergangen, um die mittelfristigen Folgen zu verspüren.
Eine ältere Netzgeneration, die mit dem
 Usenet – der Frühform eines
weltweiten sozialen Netzes – aufgewachsen ist, kann da schon auf
bedenklichere Erfahrungen zurückgreifen. Wenn sich damals jemand zum
Beispiel im jugendlichen Überschwang radikal zu diesem oder jenem geäußert
hat, kann das noch heute jeder Personalchef im Netz nachlesen. Google hat
vor ein paar Jahren DejaNews gekauft, eines der größten Usenet-Archive,
heute heißt es Usenet – der Frühform eines
weltweiten sozialen Netzes – aufgewachsen ist, kann da schon auf
bedenklichere Erfahrungen zurückgreifen. Wenn sich damals jemand zum
Beispiel im jugendlichen Überschwang radikal zu diesem oder jenem geäußert
hat, kann das noch heute jeder Personalchef im Netz nachlesen. Google hat
vor ein paar Jahren DejaNews gekauft, eines der größten Usenet-Archive,
heute heißt es
 Google Groups. Google Groups.
Neue Gegenwart:
Wo wird die Datensammlung durch den Staat oder durch Unternehmen vom
Verbraucher besonders selten als problematisch empfunden?
Glaser:
Beispielsweise bei so genannten Kundenkarten a la Payback Card, die einem aus
purer Freundlichkeit Bonuspunkte und Prämien schenken.
Neue Gegenwart:
Und: In welchen Lebensbereichen achten die Menschen am wenigsten darauf, ob
sie Datenspuren hinterlassen?
Glaser:
Eigentlich in allen.
Neue Gegenwart:
Wie kann das Bewusstsein für den Datenschutz in der Bevölkerung am besten
geweckt werden? Kommt der Medienjournalismus zu spät?
Glaser:
Das Bewusstsein ist geweckt. Aber zu viel Alarmismus in der
Berichterstattung erzeugt bei einem solchen Dauerthema Formen von Ignoranz
als Selbstschutz. Das hat man in der Umweltbewegung in den Achtzigern ebenso
gesehen wie in der so genannten Krypto-Debatte in den Neunzigern, als es um
die Frage ging, ob Privatpersonen ihre Daten verschlüsseln dürfen. Ich finde
deshalb Aktionen wie den
 Big Brother Award
gut, da wird ausgezeichnet
informiert, im doppelten Sinn. Big Brother Award
gut, da wird ausgezeichnet
informiert, im doppelten Sinn.
Neue Gegenwart:
Unternehmen versuchen über Bonussysteme Kunden zu ködern, ihr
Konsumverhalten offen zu legen. Für diese Offenlegung (Kaufkraft,
Häufigkeit, Art der Produkte etc.) erhält man nach einem Punktesystem
Prämien, zum Beispiel einen Akkusauger oder eine Küchenwaage. Warum fällt
die Unverhältnismäßigkeit zwischen Geben und Nehmen nicht auf?
Glaser:
Das frage ich mich auch. In der öffentlichen Diskussion müsste neben den
Bedrohungs-Szenarien der wirtschaftliche Wert, den meine Daten darstellen,
eine wesentlich größere Rolle spielen. Ich bin der Ansicht, dass die
Konsumenten von den datenkonsumierenden Unternehmen behandelt werden wie
Ureinwohner von Eroberern – im Vergleich zu dem Wert, den die gelieferten
Daten tatsächlich darstellen, sind Bonuspunkte und derlei Glasperlen für die
Eingeborenen.
Neue Gegenwart: Suchmaschinenunternehmen erfassen umfangreiche Daten über ihre Nutzer und
deren Verhalten und speichern diese langfristig. Um Marktzutritt in Staaten
wie China zu erhalten, sind sie oftmals zu weitreichenden Zugeständnissen
bereit. Wie kann sichergestellt werden, dass diese Unternehmen mit
Kundendaten redlich umgehen?
Glaser:
Wenn Sigmund Freud mal in der Google-Datenbank aller Nutzeranfragen hätte
wühlen können, er hätte sich gefühlt wie Onkel Dagobert in seinem
Geldspeicher beim Baden in Talern. Es ist gar nicht so einfach, sich eine
Vorstellung von dem zu machen, was eine Firma wie Google in der Hand hat,
nämlich eine Datenbank dessen, was die Menschheit möchte, was die Menschen
suchen und wollen. Google ist ein planetares Röntgengerät für unsere
Absichten, geschätzte 100 Millionen Suchanfragen werden täglich an die
Maschinen gerichtet. Und Google ist ein börsennotiertes Unternehmen. Wenn
der Aktienkurs mal eine Weile nach unten geht, werden die Google-Aktionäre
sich fragen, was sie zu verkaufen haben. Das einzige, was sie haben, sind
diese unvorstellbaren Mengen an Nutzerdaten, die natürlich auch untersucht
und aufbereitet werden. Wer sollte ihnen verbieten, Teile daraus zu
verkaufen?
Neue Gegenwart:
Wenn deutsche Nutzerdaten auf amerikanischen Servern gespeichert und
anderswo verwendet werden, entsteht vermutlich eine rechtlich problematische
Situation. Wie ist Ihre Meinung zum Verhalten dieser Unternehmen?
Glaser:
Ich bin kein Jurist, aber so wie ich es verstehe, regelt das Recht, wie wir
miteinander umgehen, das betrifft natürlich auch Unternehmen oder Staaten.
Mit der Vernetzung entsteht nun erst einmal eine sozusagen chronisch
problematische Rechtssituation, weil vieles in Bewegung gerät und neu
ausgehandelt werden muss, das Urheberrecht zum Beispiel, oder was unter
Meinungsfreiheit zu verstehen ist – in China versteht man da etwas ganz
anderes darunter als in den USA oder in Deutschland. Da gibt es auch viele
positive Entwicklungen. Ich lese seit längerem Blogs aus arabischen Ländern,
da kann man richtig dabei zusehen, wie alte, gesellschaftliche Mauern
unumkehrbar porös und durchlässig werden. Die moderne Finanzwirtschaft wäre
auch nicht möglich ohne die Tatsache, dass international operierende Banken
einfach ihre Festplatten zu exterritorialem Gebiet erklären – heute werden
ja keine Kisten mit Goldbarren mehr von hier nach da kutschiert, da fließen
goldene Bits durch die Datenleitung.
Neue Gegenwart:
Sollte hier nicht der Staat als Regulierer auftreten? Wie kann das Problem
international angegangen werden?
Glaser:
Soweit das möglich ist, passiert es ja schon. Das Netz ist kein rechtsfreier
Raum, aber internationales Recht ist eine sehr komplizierte Sache. Es gibt
längst Regulierungsmöglichkeiten, die von Kritikern als viel zu weitgehend
angesehen werden – dass zum Beispiel die Root-Server, mit deren Hilfe eine
Internet-Adresse überhaupt erst gefunden werden kann, in den USA stehen und
von dort aus bei Bedarf die Top-Level-Domain eines ganzen Landes abgeschaltet
werden kann. Oder die restriktiven Netz-Zensurmaßnahmen in China, Vietnam
oder Myanmar.
Wo sehen Sie die größten Probleme der Vorratsdatenspeicherung?
Glaser:
Die Privatsphäre und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung werden
missachtet und eingeschränkt.
Neue Gegenwart:
Die individuelle Bedeutung der Vorratsdatenspeicherung und anderer
staatlicher Maßnahmen („Bundestrojaner“ etc.) dürfte vielen nicht klar sein,
obwohl es derzeit eine politische Diskussion darüber gibt. Warum wird die
Debatte nicht plastischer geführt?
Glaser:
Das sehe ich nicht so pessimistisch. Zu der Demonstration für Demokratie und
Bürgerrechte am 22. September in Berlin sind mehr als 15.000 Menschen
gekommen. Das hat es seit der Volkszählung 1987 nicht mehr gegeben.
In der Mediengesellschaft kommt die vollständige Erfassung des
kommunikativen Verhaltens einer Totalüberwachung gleich. Glauben Sie, dass
die Bundesregierung weiß, was sie tut?
Glaser:
Ich fürchte, ja.
Neue Gegenwart:
Wie will sie dabei – Ihrer Einschätzung nach – den besonders geschützten
Kernbereich der Privatsphäre berücksichtigen?
Glaser:
Ich sehe keine Verbesserung und auch keinen Bestandsschutz, was die
Privatsphäre betrifft. Es gibt eine Tendenz, sie mit den immergleichen
Argumenten immer durchlässiger zu machen – Schutz vor Terrorismus, und wer
nichts zu verbergen hat, braucht sich nicht zu fürchten. Was für die
Erdatmosphäre im Großen gilt, gilt auch für die vielen kleinen Privatsphären
der Menschen – sie sind gefährdet durch unverantwortliche menschliche
Eingriffe.
Neue Gegenwart:
Was sind die aus Ihrer Sicht bedenklichsten Entwicklungen bezüglich des
Abbaues von Datenschutz in den vergangenen Jahren?
Glaser:
Die Lust am Exhibitionismus, von der die ganze Gesellschaft erfasst worden
ist. Vor ein paar Jahren war Big Brother Synonym für Überwachung und
Kontrolle. Als 1984 der Apple Macintosh eingeführt wurde, gab es diesen
dramatischen Werbespot mit einer Menschenmasse, die dem großen Bruder
lauscht und der jungen Frau, die ihm einen Hammer ins Gesicht wirft. Seit
den Container-Shows von de Mol steht Big Brother für moderne
Fernsehunterhaltung. Oder: Alle reden in aller Öffentlichkeit die intimsten
Dinge in ihre Mobiltelefone. Die ganze Kosumwerbung ist ein einziger,
rauschender und glitzernder Aufruf, sich zu zeigen in seiner ganzen Pracht.
Wer sollte da seine Daten schützen wollen? Datenschutz ist ungeil.
Neue Gegenwart:
Warum nutzen Sie Google trotzdem?
Glaser:
Hier such’ ich, und ich kann nicht anders.
Welche weiteren Vorstöße hinsichtlich des
Abbaues von Datensicherheit und individuellem Datenschutz prognostizieren
sie? Kurz: Was erwartet uns – Ihrer
Meinung nach – 2020?
Glaser:
Man kann eine technokratische Zukunftsprojektion machen, die ich für
wahrscheinlich halte, nämlich dass neue Hardware und Software immer auch
für staatliche Kontrollzwecke eingesetzt werden wird. Das wird auch in
Zukunft zu Pleiten führen, wie wir sie heute zum Beispiel bei der
automatischen Gesichtserkennung belächeln dürfen (oder eben nicht:
Passbilder mit lächelndem Gesicht dürfen nicht für den maschinenlesbaren
Reisepass verwendet werden).
Was ich viel interessanter finde ist die Frage, ob wir unser Geheimnis
verlieren, wenn unsere Daten und Profile einbehalten und verarbeitet
werden, oder ob da nicht noch etwas ganz anderes ist, an dem jede Maschine
scheitert. |
Zur Person

Peter Glaser
Geboren 1957 in Graz, ist Schriftsteller, Journalist und Ehrenmitglied des
Chaos Computer Clubs. 1986 bis 1996 erschien seine Kolumne "Glasers heile
Welt" in der Zeitschrift Tempo, 2002 erhielt er für seine "Geschichte von
Nichts" den Ingeborg-Bachmann-Preis. Er schreibt u. a. regelmäßig eine Kolumne für
Focus Online
(„ Gla-sers
modernste Zeiten") und publiziert im Blog der Zeitschrift Gla-sers
modernste Zeiten") und publiziert im Blog der Zeitschrift
 Technology
Review. Technology
Review. |