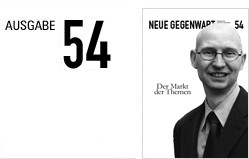|
Wenn wir eine
Liste von Wörtern zusammenstellen würden, die ein bestimmtes Land
beschreiben sollte, dann ist sehr wahrscheinlich, dass bereits nach wenigen
Begriffen klar ist, um welches Land es sich wohl handeln mag. Ein Beispiel:
Elefanten, Gold, Urlaub,
schwarze Haut, Kriminalität, Tafelberg, Apartheid. Genau! Südafrika.
Wir alle haben unsere Bilder im Kopf von bestimmten Ländern und deren
Realität. Selbst, wenn wir noch nie dort waren. Doch woher stammen diese
Bilder und Eindrücke? Zum einen sicherlich von Freunden oder Angehörigen,
die schon einmal dort waren. Im Falle von Südafrika ist es sehr
wahrscheinlich, dass wir jemanden kennen, denn pro Jahr reisen einige 10.000
Deutsche ins Land am Kap.
Natürlich könnte man auch einmal ein Buch lesen, dass sich mit der Heimat
Nelson Mandelas beschäftigt. Viel mehr Einfluss aber haben die
elektronischen Massenmedien auf unser Bild, denn sie zeigen aufgrund der
Einschaltquoten recht großen Teilen der Bevölkerung, möglicherweise bisher
eher desinteressiert am Thema, den Weg zum Tafelberg. Da haben wir Karl
Moik, der mit seinem Musikantenstadl, reitend auf eben jener Tourismuswelle,
die wunderbare Welt der Buren aufmischt. Oder es wird eine Bochumer
Tierärztin geschickt, die in einer ZDF-Schmonzette in den fernen Süden
entsandt wird, um in einer Miniausgabe des Krügerparks Babylöwen abzuholen
und sich dabei Hals über Kopf verliebt, natürlich nicht nur ins Land,
sondern auch in den lokalen Wildhüter. Ist ja klar.

Bilderstrecke: Afrika ist kein Land
Klicken Sie hier, um die
Bilderstrecke zu öffnen.

Schwieriger wird es im Falle von Ländern, die weder diesen Tourismus
aufzuweisen haben, noch sich als Projektionsfläche romantisch verklärter
Fernsehproduktionen eignen. Malawi ist so ein Fall. Malawi schafft es aber
dennoch in unsere Köpfe. Denn mit den Begriffen Madonna und Adoption können
wir seit einiger Zeit auch im Falle Malawis eine Pseudodefinition vornehmen.
Doch nur weil Frau Ritchie Probleme nach der Adoption eines malawischen
Kindes hatte, ist unser Wissen nicht geschärft. Die meisten dürften
deshalb immer noch im Dunkeln tappen, wo genau Malawi eigentlich liegt.
Also wenden wir uns besser den wirklichen Fakten zu. Oder versuchen es
zumindest. Schließlich gibt es dafür ja die journalistische Allzweckwaffe,
die Korrespondenten. Alle deutschen Mediengattungen sind in Südafrika
vertreten und berichten von hier. Nicht nur vom Land selbst, denn Südafrika
bietet ideale Voraussetzungen für die regionalen Büros der Medienhäuser.
Da sind sie nun, die Frauen und Männer, die auszogen, die Wirklichkeit ihrer
Gastländer in deutsche Wohnstuben zu bringen und dem daheimgebliebenen
Mitbürger das Geschehen hinter Afrikas grünen Hügeln zu erklären. Wie absurd
dieses Konzept tatsächlich jedoch ist, sollten uns eigentlich die
Erkenntnisse der Kriminalistik gelehrt haben. Unsicherheit kommt bei der
Verbrechensbekämpfung nämlich immer dann auf, wenn der menschliche Faktor
ins Spiel kommt, es um Zeugenaussagen geht. Jeder hat etwas anderes gesehen.
Der Mann, der die Unfallflucht begangen hat, war blond, nein glatzköpfig
oder war es doch eine Frau? Egal. Jedenfalls war es ein BMW, nein Audi,
jetzt haben wir es: ein Mercedes. Richtig?
Lassen Sie uns eines klarstellen: Dies ist keine Kollegenschelte. Im
Gegenteil. Die Arbeit in Afrika ist eine logistische Herausforderung, allein
schon wegen der Entfernungen. Dazu kommen die vielen Länder mit Ihren
dutzenden Sprachen, Südafrika alleine hat schon elf Landessprachen. Damit
nicht genug, müssen die Berichterstatter die verschiedenen Kulturen und
Stammesgeschichten berücksichtigen, über die sich unterschiedliche koloniale
Vergangenheiten und die jeweils anschließenden Befreiungsbewegungen stülpen,
hier Apartheid, dort Diktaturen. Auf der einen Seite der Grenze hat man
Erfahrung mit dem Sozialismus, auf der anderen mit dem Kapitalismus. Oft
auch mit beidem.
Zurück zur Realität, oder dem, was wir dafür halten. Wir erwarten nun von
den Abgesandten der Informationsgesellschaft, dass sie in diesem
afrikanischen Wust, von dem auch an dieser Stelle nur ein Ausschnitt
dargeboten wurde, tatsächlich in der Lage sind, die Realität in vollem
Umfang zu erkennen und eben diese Realität für uns abzubilden. Die einzig
wahre Aussage kann in diesem Zusammenhang nur lauten, dass es Realität
nicht gibt, nicht geben kann. Jedenfalls nicht die, in der in 90 TV-Sekunden
die Lebenswirklichkeit eines ganzen Landes erklärt wird. Nicht etwa, weil
die Kollegen nicht seriös arbeiten würden, oder gar falsche Eindrücke
vermitteln wollten. Es geht schlichtweg nicht. Die Zeit ist zu kurz, der
Platz zu begrenzt und darüber hinaus können sich einzelne, kleine Teams nur
einen ungefähren Überblick verschaffen, denn sie können nicht überall sein.
Trotz zuarbeitender Stringer.
Realität ist außerdem mehr als die Summe von Erfahrungen, die ein Mensch in
einem Land machen kann. Selbst wenn er professioneller Informationssammler
sein mag, denn die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns ist endlich.
Nicht nur physisch sondern auch psychisch. Auch Korrespondenten haben
Vorurteile, Vorlieben und Begrenzungen. Es sind keine Übermenschen, sondern
in der Regel mit europäischen Denkmustern vorbelastete Männer und Frauen,
denen sich die afrikanische Lebens- und Handlungsweise eben aus diesem
Grunde einfach nur bis zu einem gewissen Grad erschließen kann und daher
auch immer das Objekt von Missinterpretationen bleiben wird. Dazu kommt die
oben bereits ausgeführte Reizüberflutung, gekoppelt mit einer automatisch
eingebauten Überforderung. Da wundert es wenig, wenn im Arbeitsalltag das
Bekannte, erfolgreich Erprobte, den Vorrang erhält.
Ein Beispiel aus Südafrika: In den Redaktionsstuben der Mutterhäuser gehen
immer wieder Meldungen aus Kapstadt, Pretoria und Johannesburg ein. Für die,
die aufmerksam hinhören, wiederholen sich diese Namen, wenn es um Südafrika
geht. Die Wenigsten in Deutschland haben aber jemals von der Provinz Eastern
Cape gehört. Und das, obwohl hier viel passiert. Es ist die Provinz, in der
der im ganzen Land unangefochten herrschende African National Congress (ANC)
seine absolute Hochburg hat. Aus dieser Provinz stammen fast alle wichtigen
ANC-Führer von Mandela bis Mbeki. Hier werden milliardenteure
Strukturprogramme des Staates geplant, durchgeführt und grandios in den
Küstensand gesetzt. Mandelas verarmter Bruder, ebenso alt geworden wie sein
berühmter Verwandter, lebt hier immer noch. Deutsche Firmen wie Mercedes und
VW haben ihre Produktionsstätten vor Ort. Die Büros vieler Korrespondenten
sind kaum eine Flugstunde entfernt, die Geschichten liegen auf der Straße
und trotzdem hören wir nie von hier.
Die Gründe sind vielfältig und wie immer in Afrika ist die Erklärung
schwierig. Da sind zum einen die Korrespondenten selbst. Sie sind oft an
ihre Büros gebunden, von wo aus sie die eingehenden Informationen filtern
und weiter verarbeiten. Vor Ort ist man nur, wenn wirklich etwas los ist.
Für Abseitiges hat man erst recht keine Zeit, denn meistens kommen diese
Geschichten in der Heimatredaktion sowieso nicht gut an.
Zu Hause muss
nicht zwingend ein auslandserfahrener Kollege die Zügel in der Hand halten.
Er wird auch eher dazu neigen, nach der großen Geschichte zur Fußball-WM zu
fragen, auch wenn die schon so oder so ähnlich woanders gelaufen ist.
Möglicherweise hat er aber auch ein Faible für Autokraten, am besten mit
Heimatbezug, also ran an die neuesten verbalen Entgleisungen gegen Kanzlerin
Angela Merkel, begangen von Robert Mugabe. Solche Stücke verkaufen sich in
jedem Falle besser, als die Geschichte über Eastern Cape, die damit
definitiv tot ist.
Nun sind Medienhäuser, das wird gerne vergessen, auch und vor allem
Wirtschaftsunternehmen. Verkauft sich eine Geschichte gut, trägt das zum
Wert der Ausgabe bei. Insofern kann man dem zuständigen Redakteur keinen
Vorwurf machen. Prominenz verkauft sich eben gut, der Kunde
bekommt, wonach er verlangt. Auftrag ausgeführt. Wenn dabei das Bild von
Afrika wieder mal ein Stückchen schiefer rutscht, dann ist das eben so,
gewisse Kollateralschäden der Informationsgesellschaft scheinen eben
unvermeidbar zu sein.
Weiterhin spielt natürlich die Entfernung eine große Rolle. Ein
Grubenunglück mit zwei verletzten Bergarbeitern in einer Ruhrgebietszeche
ist eine Story, im Falle von Südafrika müssen da schon zweistellige Verluste
an Menschenleben zu vermelden sein, sonst ruft das in deutschen
Redaktionsstuben nur ein müdes Achselzucken hervor. Und selbst dann ist
nicht gesichert, dass die Geschichte bis zum Andruck überlebt. Denn der
Zeitpunkt spielt eine entscheidende Rolle. Fegt nämlich gleichzeitig ein
Tsunami Asiens Strände leer, dann sind Afrikas Bergarbeiter nur noch
Kleinvieh. Erreicht die Meldung vom Unfall den Korrespondenten nach dem
deutschen Redaktionsschluss, dann sieht es bereits schlecht aus, denn bis
Morgen kann noch eine ganze Menge passieren.
Die wichtigste und gleichzeitig perverseste aller journalistischen
Grundregeln aber hat den größten und negativsten Einfluss auf unser Bild des
afrikanischen Kontinents. Der Logik folgend, dass nur eine schlechte
Nachricht eine gute Nachricht ist, wurde Afrika in den vergangenen
Jahrzehnten zum Kontinent der Katastrophen, Bürgerkriege, Hungersnöte und
Epidemien. Eine Schreckensmeldung jagt die Nächste. Die Negativmeldungen
bügeln alles andere nieder und führen nicht nur zu einem völlig falschen
Bild, sondern verzerren so weit, dass Afrika in Europa nicht mehr als
Kontinent mit 53 völlig unterschiedlichen Ländern wahrgenommen wird, sondern
als ein einziges, zusammenhängendes Land voller Elend. Ein fataler Irrtum,
hervorgerufen durch unverschuldete Unkenntnis auf Seiten der Mediennutzer
einerseits und unvermeidbarer Realitätsferne der Medien andererseits.
Nun könnten wir eine Hitliste der vernachlässigten Themen aufstellen, wie
dies die Initiative Nachrichtenaufklärung in Deutschland tut. Dies aber wird
den afrikanischen Realitäten wieder nicht gerecht, denn auch dies kann
wieder nur ein kleiner Ausschnitt sein. Wichtiger erscheint in diesem
Zusammenhang, die Frage nach wirklicher Abhilfe zu stellen. Und da gibt es
tatsächlich nur einen Ausweg aus dem Dilemma.
Die Antwort geben die Neuen Medien. Deren Entwicklung schreitet auch in
Afrika mit großen Schritten voran und ermöglicht neue Formen der
Informationsbeschaffung. Internet, digitale Kameras und vor allem das Handy
sind Medien, die auch aus den afrikanischen Ländern nicht mehr wegzudenken
sind. Vor allem die Handyzahlen wachsen rasant. Auch in den kleinsten Orten,
in den ärmsten Landstrichen, finden sich Mobiltelefone. Das eröffnet
zunächst für die Korrespondenten vor Ort ganz neue Möglichkeiten, da die
ihnen zuarbeitenden Stringer unmittelbar Kontakt aufnehmen und berichten
können.
Aber auch für den Mediennutzer daheim hat dies Vorteile. Immer mehr
afrikanische Internetseiten gehen an den Start. Immer mehr Blogs werden
geschrieben, immer mehr digitale Fotos oder auch Videos eingestellt. Für den
proaktiven europäischen Mediennutzer ist dies eine Fundgrube an
Informationen, die nicht überschätzt werden kann. Wer nun noch die
klassischen Medien hinzuzieht, kann sich über viele Themen informieren, die
bisher einfach nicht abgedeckt wurden. Dass dieser aktive Ansatz nur für
bestimmte Nutzer in Frage kommt, weil der Mensch grundsätzlich träge und
unsere Zeit begrenzt ist, versteht sich von selbst. Dennoch verlangt eine
komplexe Welt von den Medienkonsumenten auch zunehmend eine komplexe
Mediennutzung, soll sie in in ihrer Ganzheit verstanden werden. Wie
bedeutsam übrigens die Neuen Medien auch für die Afrikaner selbst geworden
sind, zeigt die jährlich im südafrikanischen Grahamstown stattfindende
„Highway Africa“-Konferenz, zu der regelmäßig über 500 Journalisten vom
ganzen Kontinent anreisen.
Nun neigen manche deutsche Redakteure wieder zu einem Schnellschuss und
meinen, man könne jetzt ja die Korrespondenten einsparen, schließlich gäbe
es ja online alle nötigen Informationen. Dies aber ist der komplett falsche
Ansatz. Bei aller Begrenzung der Korrespondenten ist eines ganz klar: Ohne
den kritisch-filternden Blick der Journalisten, die vor Ort beurteilen, ob
das, was Blogger oder Forenbesucher täglich veröffentlichen, ernstzunehmende
Informationen sind oder eben nicht, werden die positiven Aspekte der Neuen
Medien bald von den Negativen überlagert und die afrikanische Realität wird
in Europa vollends zu einem medialen Zerrbild verkommen. |
Der Autor

Frank Windeck
Geboren 1966 in Bonn, leitet seit zwei Jahren das Medienprogramm der
Konrad-Adenauer-Stiftung für Sub-Sahara-Afrika mit Sitz in Johannesburg,
Südafrika. Studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Geographie in
Bonn und Köln. Seit 1987 für Presse, Rundfunk und Fernsehen in verschiedenen
Positionen tätig. Schwerpunkte dabei: Magazinjournalismus und
TV-Produktionsmanagement. 2001 wechselte er zur Konrad-Adenauer-Stiftung,
dort zunächst in die Journalisten-Akademie und anschließend als
Auslands-mitarbeiter nach Johannesburg.
f.windeck (at) kas.org.za |