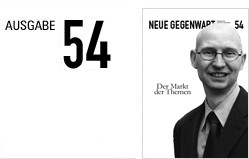|
Der
„objektive“
Informationswert

Text:
Jens O. Brelle Bild:
Photocase.com/BarneyOnFire

Das letzte Caroline-Urteil des
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 6. März vergangenen Jahres, das im Rahmen einer ganzen
Reihe von Entscheidungen zu Klagen derselben Kläger ergangen ist, setzt neue
Maßstäbe im Verhältnis von Privatsphäre und Pressefreiheit in der deutschen
Rechtsprechungsgeschichte.
Im Mittelpunkt dieser Entscheidung steht das
Caroline-Urteil des Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vom
24. Juni 2004, das von der deutschen Rechtsprechung im Hinblick auf
Presseveröffentlichungen einen stärkeren Schutz Prominenter fordert.
Das Bundesverfassungsgericht und der BGH hielten bisher einen
Eingriff in die Privatsphäre eines Prominenten, wie Caroline von Hannover,
durch die Heranziehung des Instituts der absoluten Person der Zeitgeschichte
grundsätzlich für zulässig. Um die mit dem letzten BGH-Urteil einhergehenden
Veränderungen zu verdeutlichen, sollen im Folgenden zunächst die einzelnen,
in diesem Zusammenhang maßgeblichen Entscheidungen näher dargestellt werden.
Bislang hielt sich die gesamte höchstrichterliche Rechtsprechung in
Deutschland zur Veröffentlichung von Bildnissen an den von ihr entwickelten
Maßgaben der (relativen und absoluten) Person der Zeitgeschichte.
Caroline
von Hannover (ehemals von Monaco) wird von der Rechtsprechung unstreitig als
absolute Person der Zeitgeschichte angesehen. Der Begriff „absolute Person
der Zeitgeschichte“ wird in der Rechtsprechung und Literatur für Personen
verstanden, die unabhängig von einem bestimmten Ereignis aufgrund ihres
Status oder ihrer Bedeutung allgemein öffentliche Aufmerksamkeit finden und
deren Bildnis die Öffentlichkeit deshalb um der dargestellten Person willen
der Beachtung wert findet.
Eine absolute Person der Zeitgeschichte muss die Veröffentlichung von Fotos
grundsätzlich hinnehmen, da ein absolutes Informationsinteresse der
Allgemeinheit besteht. Von diesem Grundsatz macht die Rechtsprechung auch
Ausnahmen, zum Beispiel wenn sich die betroffene Person erkennbar in eine örtliche
Abgeschiedenheit zurückgezogen hat, aber auch wenn sie in Begleitung ihrer
Kinder zu sehen sind. Hat sich also die betroffene Person nicht erkennbar
zurückgezogen, kann eine in der Öffentlichkeit gemachte Fotoaufnahme einer
absoluten Person der Zeitgeschichte veröffentlicht werden.
So hat das Bundesverfassungsgericht beispielsweise ein Pressefoto als verfassungsmäßig beurteilt, das
zeigt, wie Caroline von Hannover in einer öffentlichen Badeanstalt über ein
Hindernis stolpert und zu Boden stürzt. Das Gericht begründete diese
Entscheidung damit, dass es sich bei einer öffentlichen Badeanstalt um
keinen abgeschiedenen Ort handle. In einem zuvor ergangenen Urteil hingegen
hatte es der Bundesgerichtshof im Jahre 1995 als unzulässig angesehen, Fotos von Caroline
von Hannover zu veröffentlichen, die sie gemeinsam mit einem Schauspieler in
einem Gartenlokal zeigte. Als Begründung führte das Gericht aus, dass in
dieser Situation für alle Personen in ihrer Nähe objektiv erkennbar gewesen,
dass die Prinzessin allein sein wolle und sich im Vertrauen auf die
Abgeschiedenheit so verhalten habe, wie sie es in der breiten Öffentlichkeit
nicht tun würde. Nach Ansicht des BGH habe es sich bei der Berichterstattung
hierüber lediglich um bloße Neugier gehandelt, welche nicht schutzwürdig
wäre.
In dem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ging es um die Beschwerde von Caroline von
Hannover, mit der sie geltend gemacht hat, die Entscheidungen der
deutschen Gerichte würden gegen ihr Recht auf Achtung ihres Privatlebens
verstoßen, da sie ihr keinen angemessenen Schutz bezüglich
Presseveröffentlichungen bieten würden. Sie beruft sich dabei auf Artikel 8
der Europäischen Menschenrechtskonvention. Unter den angefochtenen Fotos
befindet sich auch jenes, welches die Prinzessin beim Stolpern im Schwimmbad zeigt.
Der EGMR gab Caroline von Hannover Recht. Begründung: Die deutsche
Rechtsprechung sei mit den von ihr angewandten Kriterien nicht in der Lage,
den Schutz der Privatsphäre gewährleisten zu können. Bei der Abwägung
zwischen dem Schutz des Privatlebens und der Freiheit der Meinungsäußerung
sei darauf abzustellen, ob Fotoaufnahmen und Presseartikel zu einer
öffentlichen Diskussion über eine Frage allgemeinen Interesses beitragen.
Die Fotoaufnahmen im Fall Caroline von Hannover dienten lediglich zur
Befriedigung der Neugier eines bestimmten Publikums, denn die Öffentlichkeit
könne kein legitimes Interesse daran haben, wo sich die Prinzessin aufhält
und wie sie sich in ihrem Privatleben verhält, auch wenn sie sich an
öffentliche Orte begebe.
Die Entscheidung des BGH vom 6. 3. 2007
Der
Entscheidung vom 6. März 2007 (VI ZR 13/06) lag folgender Sachverhalt
zugrunde: Der Kläger ist Oberhaupt des Welfenhauses und Ehemann der ältesten
Tochter des verstorbenen Fürsten von Monaco. Die Beklagte verlegt die
Zeitschrift „Frau Aktuell“. In ihrer Ausgabe Nr. 9/2002 vom 20. Februar 2002 wurde berichtet, dass es dem Fürsten von Monaco „wieder einmal
sehr schlecht gehen soll“ und dass er Besuch nur von seiner jüngsten Tochter
erhalten habe, seine älteste Tochter, die Ehefrau des Klägers, aber mit
ihrem Ehemann und ihrem Töchterchen ein paar Tage zum Skiurlaub in St.
Moritz weile. Illustriert war diese Berichterstattung unter anderem mit der
beanstandeten Aufnahme, welche den Kläger neben seiner Ehefrau auf der
Straße in St. Moritz zeigt. Der Kläger verlangt – wie seine Ehefrau im
Verfahren VI ZR 14/06 – von der Beklagten, es zu unterlassen, diese
Aufnahme erneut zu veröffentlichen.
Im Rahmen der Interessenabwägung zwischen öffentlichem Interesse und
Privatsphäre berücksichtigt der BGH erstmalig das Urteil des EGMR vom 24.
Juni
2004. Nach Ansicht des BGH muss auch bei absoluten Personen der
Zeitgeschichte der Informationswert der Berichterstattung in die
Interessenabwägung einfließen. Dabei liege der Schwerpunkt für das Abbilden
besagter Fotoaufnahmen gerade nicht mehr nur in der Person selbst, vielmehr
müsse nun auch die dazugehörige Wortberichterstattung herangezogen werden.
In diesem Verfahren hielt der BGH nur die Fotoaufnahmen des Ehepaares von
Hannover für zulässig, welche im Zusammenhang mit der Wortberichterstattung
über die Erkrankung des damals regierenden Fürsten von Monaco veröffentlicht
worden sind, denn bei dieser Erkrankung handle es sich um ein
zeitgeschichtliches Ereignis, über das die Presse berichten dürfe. Die
ferner beanstandeten Fotoaufnahmen seien aber ohne Einwilligung der
Abgebildeten unzulässig, da den Begleittexten eben kein Beitrag zu einer
Materie von allgemeinem Interesse zu entnehmen sei.
Künftig sei also eine inhaltliche Wertung der Berichterstattung vorzunehmen:
Je geringer der Informationswert der Meldung für die Allgemeinheit ist,
desto stärker fällt der Schutz des Persönlichkeitsrechts ins Gewicht.
Folgen für die Praxis
Mit den letzten Entscheidungen macht der BGH einen großen Schritt in zwei
verschiedene Richtungen. Auf der einen Seite soll nun ein noch stärkerer
Schutz im Hinblick auf das Persönlichkeitsrecht Prominenter gewährleistet
sein, auf der anderen Seite soll aber auch der Spielraum der Medien für ihre
Berichterstattungen weit bleiben. Die Grundüberlegungen des BGH überzeugen
zwar grundsätzlich, können im Ergebnis jedoch schwer in Einklang gebracht
werden.
Allein das Kriterium eines „Beitrags zu einer Debatte von allgemeinem
Interesse“ bzw. „objektiven Informationswert“ ist zu unbestimmt. Wann ist
eine Debatte allgemein interessant, wann hat eine Information objektiven
Informationswert? Wirklich objektiv lässt sich dies wohl kaum bestimmen,
denn wie allgemein ist der Kreis derer, deren Interesse durch eine
stolpernde Caroline von Hannover befriedigt wird? Fraglich bleibt, woran der
Grad des Informationsinteresses der Allgemeinheit festgemacht wird und wann
überhaupt von „Allgemeinheit“ gesprochen werden kann. So ist zum Beispiel das
Informationsinteresse eines „Bunte“-Lesers ein ganz anderes als eines „Spiegel“-Lesers. Welcher Maßstab soll jedoch zur Bestimmung des allgemeinen
Informationsinteresses maßgebend entscheidend sein?
Welchen Informationswert hat die Frage, ob und wie verliebt ein deutscher
Nationaltorwart seiner neuen Geliebten auf der Promenade von St.Tropez in
die Augen schaut? Welchen Informationswert hat die Frage, ob (und mit
welchem Detail) dieser Torwart „hosenmäßig voll im Trend“ ist, wie es ein
anderes Foto in derselben Illustrierten suggerierte? Der erste Fall vor dem
BGH ist noch nicht entschieden, gegen das zweite Foto hatte sich Oliver Kahn
bereits außergerichtlich erfolgreich zur Wehr gesetzt.
Was den einen interessiert, hat für den anderen möglicherweise keinerlei
Informationswert. Der BGH stellt selbst fest, dass auch durch unterhaltende
Beiträge Meinungsbildung stattfinden kann, auch solche Beiträge können also
ausreichenden Informationswert haben. Das Merkmal der „Befriedigung bloßer
Neugier“ bleibt allerdings undefiniert.
Möglicherweise werden es die Medien zukünftig unter Berufung auf das
aktuelle BGH-Urteil ausnutzen, eine legitime Wortberichterstattung mit einer
ansonsten unzulässigen Bildberichterstattung zu verknüpfen, um im Ergebnis
eine insgesamt zulässige Berichterstattung zu erreichen.
Die Entscheidung des BGH eröffnet Interpretationsspielräume. Für künftige
Entscheidungen solcher Fälle fehlt jedoch noch der „rote Faden“.
Einheitliche Kriterien und Rechtsfiguren – so wie bei der absoluten Person
der Zeitgeschichte – gibt es bisher jedoch nicht. In den künftigen
Entscheidungen der Gerichte sollten daher – für bestimmte Fallgruppen –
konkrete objektive Kriterien zur Abwägung von Schutz der
Persönlichkeitsrechte gegen Pressefreiheit entwickelt werden, wie z. B. die
Merkmale der Abgeschiedenheit, der Begleitpersonen mit Kindern sowie für die
Rechtsfigur der „Person der absoluten Zeitgeschichte“. |

|

Ausgabe
54
Der Markt der Themen
Startseite
Editorial von Björn Brückerhoff
Neue
Kommunikationsstrategie: Ehrlichkeit / Interview mit Thomas Pleil
Warum es manche
Themen nicht in die Medien schaffen
Afghanistan: Gibt es eine
Medienstrategie der Taliban?
Aufmerksamkeit ist nicht
alles
USA: Medienkrieg,
Kriegsmedien
Afrika ist kein Land
Ich und die anderen
Themen
Der objektive
Informationswert
Autoren dieser Ausgabe

Impressum
Newsletter bestellen
Stichwort- und
Personenverzeichnis
Alle Ausgaben: Volltextarchiv
Presse
Link in del.icio.us ablegen

Artikel drucken

|