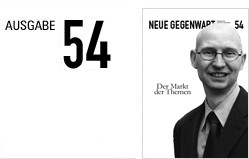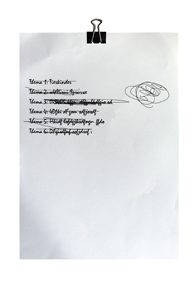|
Ich und
die anderen Themen

Text:
Petra Bäumer
Bild:
Antonio Jiménez Alonso (Bearbeitung: Neue Gegenwart)

Glaubt man dem Fernsehen, dann gibt es
nur eine Sorte Journalist: Jene mit dem Finger in der Wunde, der Nase
Richtung Zeitgeist und mit permanenter Gänsehaut von ihrem Gespür für
Themen.
So gesehen ist es verständlich,
dass viele Journalisten-Ratgeber das Kapitel Themenfindung überspringen:
Liegt dies nicht ohnehin jedem Journalisten im Blut? Walther von LaRoche
jedoch fängt in seiner „Einführung in den praktischen Journalismus“ ganz
vorne an und beschreibt den Drei-Schritt der journalistischen Arbeit: Ideen
finden, recherchieren, schreiben.
Die Idee finden – „Das kann auch auf der Treppe
passieren“ heißt es bei ihm. Man müsse nur richtig hinhören. Selbst wer dies
nicht tut, hört den Allgemeinplatz, der nach wie vor am lautesten durch die
Redaktions-Gänge hallt: „Die Themen liegen doch auf der Straße!“ Bei LaRoche
und anderen sind darüber hinaus jedoch durchaus Tipps zu finden, die
systematisches Vorgehen erfordern. Beispielsweise die Frequentierung von
Kontakten und Informanten. Hiermit sind nicht nur Whistleblower in der
Regierung gemeint, sondern auch Leser, Zuschauer oder Hörer. Dieses Vorgehen
praktiziert das Bild-Lesertelefon, wenn an seinem Hörer Bild-Praktikanten
auf eine Story hoffen. Eine weitere Quelle sind andere Medien, unter anderem
Fachmedien, in deren Randnotizen sich manchmal Spannendes versteckt.
Die beste Themenidee bleibt aber jene, die einen Nerv in der Gesellschaft
trifft. Um ein Trendsurfer zu werden, helfen tatsächlich Statistiken genauso
wie die persönliche – nicht immer valide – Erfahrung. Auf diese Weise
wurde auch die „Generation Praktikum“ als Thema losgetreten und zog einen
Rattenschwanz an Folgebeiträgen nach sich. Die weiteren Wege zum „Thema X“
sind bekannt: Pressemitteilungen, Veranstaltungen, nicht zuletzt
Agenturmeldungen, deren globale oder nationale Themen im besten Fall auf den
eigenen Radius runtergebrochen werden. Welcher Journalist ist noch nie in
die Verlegenheit gekommen, auf Veranstaltungskalender, die Terminübersicht
der Deutschen Welle oder die Möglichkeiten von Wikipedia zurückzugreifen?
Manchmal sucht man hier nur, um dem Unvermeidlichen auszuweichen, den ganz
eigenen Muss-Themen jedes Mediums: Landtagswahlen, Rosenmontagsumzüge,
Drei-Wochen-Sixpacks, Fett-weg-Diäten oder Oscar-Verleihungen.
Ob von der Straße oder aus dem Bundeskanzleramt, alle Themen müssen zuerst
eine Hürde schaffen. Am Ende entscheidet natürlich die Zielgruppe, indem sie
ihre Gunst zu- oder aberkennt. Was aber der Leser will, entscheidet mitunter
der Chefredakteur – oder gar der Verleger selbst. Täglich jedoch
entscheidet die Redaktion – die Redaktionskonferenz. Hier werden Themen
geplant, Ideen vorgeschlagen, besprochen, angeregt, verändert, rausgekickt
oder in der Blattkritik erschienene Artikel gelobt oder getadelt. Daraus
resultieren Potenziale: Aus halbgaren Ideen werden gemeinsam neue, bessere
Themen gemacht. Insofern bestätigt eine Studie der Universität Leipzig die
Konferenz als wichtiges Instrument des Redaktionsmanagements. Genauso wie
als entscheidende Sozialinstanz.
Wie immer wenn es um Menschen geht, entsteht ein komplexes soziales Gebilde,
funktioniert die Redaktion als organisiertes soziales System. Damit gewinnt
nicht nur ein Thema, sondern auch dessen Präsentation und die Person
dahinter. Weil nicht jeder Nachrichtenwert so eindeutig akzeptiert wird –
wie vielleicht die Hochzeit von Nicolas Sarkozy und Carla Bruni – heißt es,
Überzeugungsarbeit leisten.
|
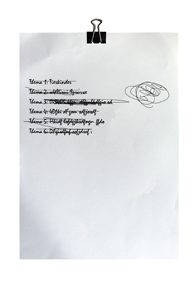
|

Ausgabe
54
Der Markt der Themen
Startseite
Editorial von Björn Brückerhoff
Neue
Kommunikationsstrategie: Ehrlichkeit / Interview mit Thomas Pleil
Warum es manche
Themen nicht in die Medien schaffen
Afghanistan: Gibt es eine
Medienstrategie der Taliban?
Aufmerksamkeit ist nicht
alles
USA: Medienkrieg,
Kriegsmedien
Afrika ist kein Land
Ich und die anderen
Themen
Der objektive
Informationswert
Autoren dieser Ausgabe

Impressum
Newsletter bestellen
Stichwort- und
Personenverzeichnis
Alle Ausgaben: Volltextarchiv
Presse
Link in del.icio.us ablegen

Artikel drucken

|
|
Während freie Journalisten zwingend wissen, wie sie ihre Idee verkaufen
müssen, bleibt es für andere ein noch unentdecktes Thema: Präsentation.
„Alles wurde uns beigebracht. Das allerdings nicht.“, sagt Julia Bähr,
Absolventin der Deutschen Journalistenschule. In ihrer Abschlussarbeit
„Meinungsmache unter Meinungsmachern“ hat sie sich mit den
zwischenmenschlichen Faktoren in der Themenplanung auseinandergesetzt.
In einer qualitativen Befragung mit 14 Redakteuren und Volontären
unterschiedlicher Ressorts regionaler und überregionaler Tageszeitungen
untersuchte sie dabei vor allem die Prozesse in der Redaktionskonferenz. Im
Gegensatz zu vorherigen Studien, die sich größtenteils auf den Einfluss des
Verlegers bezogen, ging es ihr um die Gruppendynamik unter Gleichgestellten.
„Aufgrund der qualitativen Methode handelt es sich nicht um repräsentative
Zahlen, sondern es gibt ein Stimmungsbild wieder“, beschreibt Bähr ihre
Ergebnisse. Neue Gegenwart hat mit ihr gesprochen.
Neue Gegenwart: Apropos
Themenfindung: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Einfluss der Kollegen
auf die Themenfindung unter die Lupe zu nehmen?
Julia Bähr: Während meiner Hospitanzen habe ich Konferenzen erlebt, die mich
an der Objektivität der Nachrichtenauswahl zweifeln ließen. Manchmal lief
alles sehr offen ab, aber manchmal hatte ich auch den Eindruck, es gibt
Redaktionsprügelknaben, die keinen Fuß auf den Boden bekommen – obwohl ihre
Themen nicht schlechter waren. Es hat mich daher sehr interessiert, ob sich
mein Eindruck mit dem von anderen Journalisten deckt. Meine Vermutung war,
dass manchmal mehr zwischenmenschliche als fachliche Faktoren bei der
Themenplanung entscheiden.
Neue Gegenwart: Inwiefern ist das Konzept der
Redaktionskonferenz schwierig?
Julia Bähr: Das Hauptproblem der Konferenz besteht eigentlich darin, dass
die meisten Journalisten zu allem eine Meinung haben
– und sie gerne äußern.
Dabei entsteht häufig eine Diskussion, bei der die Profiliertesten und
Eloquentesten gewinnen. Die Alphatiere eben. Teilweise ist aber auch nach
der Diskussion nichts klar, dann entscheidet der Chef alleine. Ungefähr die
Hälfte der Befragten beschrieben eine weitgehend demokratische
Entscheidungsfindung
– bei den anderen wirkt der Chef als letzte Instanz.
Neue Gegenwart: Was genau ist
problematisch daran, wenn der Lauteste in der Runde sein Thema durchbringt?
Julia Bähr: Es verändert die Zeitung. Unter Umständen kommt nicht das beste
Thema durch, sondern das des besten Verkäufers. Der
perfekte Themensetzer ist durchsetzungsfähig, kompetent, trägt sein Thema
überzeugend und eloquent vor. Er hat durch seine Erfahrung Respekt erworben,
ist beliebt und fleißig. Ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt und etwas
Witz sind ebenfalls positive Faktoren. Im Moment der Redaktionskonferenz
stimmen ihm also alle zu. Erst im Nachhinein verfliegt die Blenderfunktion
und es zeigt sich, was das Thema taugt. So beschrieben beispielsweise zwei
Redakteure einer Zeitung den Fall eines Kollegen, der stets seine Themen
durchsetzte – am nächsten Tag wunderte man sich jedoch, was diese im Blatt
zu suchen hatten. So etwas ist ungerecht gegenüber den Kollegen, die sich
nicht gut verkaufen können und gegenüber den Lesern, die einen suboptimalen
Artikel vorgesetzt bekommen, weil der Redakteur hausintern ein
Performancewunder ist.
Neue Gegenwart: Inwieweit wird
damit Druck in der Konferenz ausgeübt? Wird zum Beispiel schnell unsachlich oder
unstrukturiert diskutiert?
Julia Bähr: Es gibt durchaus unterschiedliche Kulturen. Wer in einer
Konferenz einen Themenvorschlag äußert, kann auf drei Arten von Reaktionen
stoßen: Interessierte Nachfrage, Ignoranz oder Unmutsäußerungen. Die letzten
beiden führen, wenn sie regelmäßig auftreten, zwangsläufig dazu, dass die
Hemmschwelle steigt: Warum sollte ich etwas vorschlagen, wenn die Kollegen
immer "schlechtes Thema" sagen, stöhnen oder die Augen verdrehen? Zudem wird
auch vor Killerphrasen nicht Halt gemacht: „Find ich langweilig“, „Passt
nicht ins Blatt“ usw.
Neue Gegenwart: Ist das lediglich
der
Machtkampf unter Kollegen? Was ist der Grund für dieses Abschmettern?
Julia Bähr: Häufig ist es schlicht eine Geschmacksfrage. Ein Kollege denkt,
etwas passe in seine Zeitung, andere sind vom Gegenteil überzeugt. Natürlich
ist eine Konferenz auch eine gute Gelegenheit sich zu profilieren und in
der Hackordnung aufzusteigen. Zudem lässt sich der ausgeprägte kritische
Geist des Journalisten bei dieser Gelegenheit hervorragend präsentieren.
Neue Gegenwart: Was ist die Folge?
Julia Bähr: Die Redakteure fühlen sich zurückgesetzt. Das kann dazu führen,
dass sie immer verzagter werden und beim nächsten Mal stotternd, unsicher
und defensiv ihren Vorschlag vortragen
– was ihre Chancen zusätzlich
mindert. Auch von persönlichen Angriffen haben viele Befragte erzählt: Die
Diskussion wird unsachlich, man unterstellt dem Kollegen Faulheit oder
fehlende Sachkenntnis. „Ich bin auf der Verliererseite – also bin ich still“ lautet
eine der Reaktionen. Von den Befragten gab zwar keiner an, entgegen seiner
eigenen Meinung zu stimmen - aber einige schweigen, wenn sie sich in der
Minderheit fühlen. Manche glauben, durch eine Äußerung nichts bewegen zu
können. Einer gab an, er wolle nicht für unkollegial gehalten werden.
Anderen ist es schlicht gleichgültig, schließlich ist die Zeitung übermorgen
schon wieder uralt.
Neue Gegenwart: Gibt es denn für
jene, die keine Präsentationskünstler sind, Wege ihre Themen durchzuboxen?
Julia Bähr: Das vorherige Schaffen von social support ist sicher die
wichtigste Taktik: Sich beim Zimmerkollegen vorab Unterstützung zu sichern,
damit man in der Konferenz einen Fürsprecher hat. Andere nehmen direkt
Kontakt mit dem Ressortleiter auf – da dessen Urteil weniger gefürchtet wird
als der geballte Unmut der Kollegen. Oder es wird damit argumentiert, was
man in letzter Zeit schon alles nicht machen durfte. Auch das Drehen des
Themas in eine bestimmte Richtung ist beliebt, ebenso die Hinzuerfindung von
spannenden Details. Viele schauen auch erst, wie die Stimmung gerade ist und
warten dann auf einen günstigeren Zeitpunkt. Eine Befragte erzählte, es gebe
sogar Kollegen, die einfach gar nicht mehr in die Konferenz kämen. Auch ein
effektives Mittel.
Neue Gegenwart: Trotzdem bleibt
die Konferenz an sich ein anerkanntes Instrument: Gibt es überhaupt Alternativen?
Julia Bähr: Eine Frage in meiner Untersuchung lautete: "Stellen Sie sich
vor, die Themen würden nicht in der Gruppe diskutiert, sondern eingereicht
und in einer geheimen Abstimmung entschieden. Sähe die Zeitung dann anders
aus?" Von den 14 Befragten sagten drei "Nein". Drei waren sich unsicher. Die
anderen erwarteten bessere Chancen für andere Themen. Eine faire Alternative
wäre es tatsächlich, schriftlich anonyme Vorschläge einzureichen, über die
diskutiert wird. Die unpopulären Themen hätten dann zwar weiterhin Probleme,
aber es hinge nicht mehr an der Person des vorschlagenden Redakteurs. Den
Aufwand dieser Methode möchte ich mir allerdings nicht ausmalen. Für
Tageszeitungen ist sie sicher ungeeignet. |

Zur Person

Julia Bähr
Geboren 1982 in Heidelberg, ist Absolventin der Deutschen
Journalistenschule. Sie lebt als freie Journalistin in München. Für die
Feuilletons von FAZ und Abendzeitung schreibt sie über Literatur und Pop,
für die NEON über alles andere. Ihre Studie wird im Tectum-Verlag
erscheinen. |