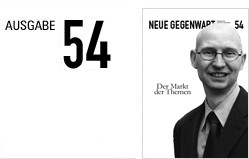|
22.30
Uhr in Philadelphia, eben sind die Lokalnachrichten auf Fox 29 zu Ende
gegangen. Der Aufmacher war die Nachricht, dass der deutsche Smart nun auch
auf der anderen Seite des Atlantiks angekommen ist. Die lokalen Stationen
von ABC, NBC und CBS beginnen ihre Nachrichtensendungen live vom Brand einer
Lagerhalle.
Gestern hat John McCain die Vorwahlen in Florida gewonnen, heute sind John
Edwards und Rudy Giuliani aus dem Rennen um das Amt des Präsidenten
ausgeschieden, und Justizminister Michael Mukasey hat in einem Brief an den
US-Senat erklärt, die Foltermethode Waterboarding sei eigentlich nicht
wirklich illegal. Heute Morgen ist mir die amerikanische Medienlandschaft
schon einmal über die Leber gelaufen, als ich in der ehrwürdigen New York
Times auch keine Kritik an den Foltermethoden der CIA gelesen habe.
Es war einmal vor vielen Jahren, 1972 und gar nicht weit von hier, da sah
der amerikanische Journalismus noch ganz anders aus. Die Watergate-Affäre,
die Richard Nixon das Oval Office kostete und Bob Woodward und Carl
Bernstein von der Washington Post zu Galionsfiguren des investigativen
Journalismus machte, war Auftakt zu einer Ära, in der der amerikanische
Journalismus Vorbild für andere nationale Mediensysteme wurde, zum Beispiel
für die oft zerstrittene Parteienpresse in Europa. Die Tage des
investigativen Journalismus sind in den USA vorbei, vorerst. Die
Terror-Anschläge vom 11. September 2001 haben auch die Medienlandschaft
nachhaltig verändert. In den Monaten nach den Anschlägen war es der Presse
unmöglich, die Politik der Bush-Regierung kritisch zu analysieren – und
seitdem haben sich die Journalisten daran gewöhnt, Regierungsquellen
weitgehend unkommentiert wiederzugeben.
Linke Kritiker, wie zum Beispiel der kalifornische
Kommunikations-wissenschaftler Douglas Kellner, sehen den Mangel einer
kritischen Debatte in den Medien als Symptom einer Krise der amerikanischen
Demokratie. In einem demokratischen
Staat hätten Journalisten die Aufgabe, politisch relevante Themen zu
diskutieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Während des „Krieges
gegen den Terror“ habe es aber nur einseitige
Berichterstattung zugunsten der Bush-Regierung und der Pentagon-Politik
gegeben. Fanatiker der rechten Seite des politischen Spektrums hätten
über einen langen Zeitraum hinweg in den Medien ein williges Forum für die
Verbreitung extremer Meinungen gefunden. Die Kolumnistin Ann Coulter hatte
zu dieser Zeit kein Problem, in der Zeitschrift National Review dazu
aufzurufen, die Führer der islamischen Welt umzubringen und die islamischen
Länder zum Christentum zu konvertieren.
Die Bush-Regierung verbreitet seit 2001 eine beispiellose Kriegs-Hysterie,
von den Medien willig aufgenommen und an die Bevölkerung weitergegeben. Ganz
besonders auffällig war der aggressive militärische Ton der
Fernsehnachrichten nach dem 11. September. Nachrichten wurden mit visuell
eindringlich gestalteten Parolen präsentiert, die die Kriegsrhetorik der
Regierung wiedergaben: Auf Fox News, CNN, MSNBC und in den
Nachrichtensendungen der großen Sender ABC, CBS und NBC wurden die
Nachrichten unter Bannern wie „America’s New War“, „America Rising“, „Attack
on America“ präsentiert. Die amerikanische Flagge war, natürlich,
allgegenwärtig. Flaggenjournalismus nennt das Sandra Borden von der Western
Michigan University.
In Kriegszeiten schart sich das Volk um seine Führer – der „rally around the
flag“-Effekt. Demokratische Prinzipien bleiben hinter bedingungslosem
Patriotismus zurück, wer öffentlich Kritik am Kurs der Regierung übt, wird
zum gesellschaftlichen Außenseiter und muss mit Konsequenzen rechnen.
Pulitzer-Preisträger Peter Arnett, der 1991 aus dem Irak über den Golf-Krieg
berichtet hatte, wurde 2003 von NBC gefeuert, nachdem er in einem Interview
mit einem irakischen Fernsehsender erklärte, der amerikanische Einmarsch in
den Irak sei nicht durchdacht und schlecht organisiert. Kurz nach dem
Interview unterstützte NBC seinen Star-Reporter noch, der habe ja nur eine
neutrale Analyse des Krieges präsentiert. Wenige Tage später hieß es aus der
NBC-Zentrale in New York, Arnett habe einen Fehler gemacht, als er seine
persönlichen Meinungen über einen vom irakischen Regime kontrollierten
Fernsehsender verbreitete.
Nun lässt sich freilich diskutieren, ob in Krisenzeiten die Medien nicht
sogar die Aufgabe haben, mit ihrer Berichterstattung zur nationalen Einheit
beizutragen. Möglich – aber ganz sicher nicht bedingungslos. Die normative
Hauptfunktion der Medien in einer Demokratie ist es, die Öffentlichkeit über
politische Ereignisse zu informieren und aufzuklären. Wie erfolgreich die
amerikanischen Journalisten damit waren, spiegelt sich zum Beispiel in den
berüchtigten Umfragen wieder, nach denen 70 Prozent der Amerikaner überzeugt
waren, dass Saddam Hussein in die Anschläge vom 11. September verwickelt
war. Die Medien zweifelten nicht daran, dass eine Invasion des Irak nach dem
Einmarsch in Afghanistan der logische zweite Schritt im Krieg gegen den
Terror war, und mit den Journalisten war auch ihr Publikum militaristisch
gestimmt.
Die Selbst-Zensur der amerikanischen Medien in den vergangenen Jahren ist
ein erstaunliches Phänomen. Üblicherweise haben Politiker nur wenige
Chancen, ihnen unbequeme Nachrichten aus den Medien herauszuhalten. Nach dem
11. September musste die Regierung in den USA den Medien erst gar keinen
Maulkorb umbinden, die hielten von selbst den Mund. Die
Patriotismus-Hysterie, von Bush mit der Maxime auf die Spitze getrieben, wer
nicht für Amerika sei, sei gegen Amerika, hatte den öffentlichen Verstand
auch in den Medien lahm gelegt.
Kriegszeiten sind Hochzeiten für Propaganda, im In- und im Ausland. Nach dem
11. September hatte die amerikanische Regierung das Office of Strategic
Influence (OSI) eingerichtet, eine Propagandamaschine, die gezielt
Desinformationen an ausländische Medien übermittelte. Nachdem 2002 die
Existenz dieser Behörde bekannt wurde, musste sie schnell geschlossen
werden, denn hier wollten die amerikanischen Medien ihre konstitutionell
garantierte Freiheit doch nicht aufgeben: Viele Nachrichtenorganisationen in
den USA arbeiten mit ausländischen Medien zusammen und bekamen die falschen
Informationen aus dem OSI postwendend in ihre eigenen Redaktionen zurück.
Das ist ein Effekt der Globalisierung und neuer Kommunikationstechnologien:
Während die US-Regierung im Inland keine Propaganda betreiben darf, darf sie
durchaus falsche Informationen an ausländische Medien weitergeben. Da jedoch
ein großer Teil der Medien international von nur wenigen Konzernen
kontrolliert wird, lässt sich die nationale Grenzlinie nicht mehr ziehen,
und die Wirkungen der amerikanischen Propaganda im Ausland betreffen auch
das inländische Publikum. Von der Regierung in die Medienwelt gesetzte
Fehlinformationen gelangten also auch in amerikanische Redaktionen, und es
gibt wenige Anzeichen, dass sich die verantwortlichen Herausgeber und
Redakteure die Mühe machten, die Mitteilungen der Bush-Regierung zu
hinterfragen. Während der Rest der westlichen Welt gespannt den
Waffeninspektoren der UNO lauschte, berichtete die amerikanische Presse von
Saddams Massenvernichtungswaffen und seiner Beteiligung an den
Terroranschlägen auf das World Trade Center. Es ist fraglich, ob die
Bevölkerung der Invasion ebenso enthusiastisch zugestimmt hätte, falls die
Presse die Position der US-Regierung zur unmittelbaren Bedrohung durch den
Irak stärker hinterfragt hätte. Es lässt sich ebenfalls spekulieren, ob der
allgemeine Glaube an ein Atomwaffen-Programm im Iran ähnliche Ursachen hat.
Nancy Snow und Philip Taylor, Spezialisten für Propaganda-Forschung,
erklären den Erfolg der Gleichschaltung der amerikanischen Presse nach den
Terroranschlägen mit der wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeit der
Medien. Die Inhaber von Medienorganisationen gehörten oft selbst zur
politischen Elite und hätten daher die gleichen Ziele wie die
Bush-Regierung. Profit sei wichtiger als die Wahrheit – aber die Presse sei
nun mal nicht schon dann frei, wenn Herausgeber rhetorisch auf dieser
Freiheit bestehen.
Möglicherweise ist es ja sogar das Ideal der objektiven Berichterstattung,
das die amerikanischen Journalisten zumindest eine Zeit lang zu Sprachrohren
der PR-Strategen im Weißen Haus gemacht hat. Brent Cunningham, Herausgeber
des Columbia Journalism Review, fragte 2003, ob der Versuch, fair und
ausgewogen zu berichten, die Journalisten zu passiven Befehlsempfängern der
Regierung gemacht hätte. Der Druck der täglichen Publikations-Deadlines
könne dazu verleiten, das Recherchieren auf nur wenige Quellen zu
beschränken. Eine tiefere Analyse falle dem Primat der Aktualität zum Opfer.
Seit 2001 verließen sich amerikanische Journalisten deshalb deutlich
häufiger auf offizielle Quellen als in den Jahren des investigativen
Journalismus.
Im Geburtsland der freien Presse haben mehrere Jahre lang Zensur und
Propaganda über die Ideale von Objektivität und Aufklärung dominiert. Snow
und Taylor nennen diese Dominanz einen Sieg autoritärer über demokratische
Werte. Eine ganze Weile schien es in der amerikanischen Medienlandschaft
keine Oase der Vernunft zu geben, selbst die New York Times und die
Washington Post blieben lieber auf Regierungslinie. Immerhin, die
Berichterstattung über Bush und seine Getreuen ist mittlerweile wieder etwas
kritischer geworden. 2004 hat sich die New York Times öffentlich dafür
entschuldigt, in den ersten Jahren des Irak-Krieges das Vorgehen der
Regierung nicht ausreichend hinterfragt zu haben.
Mit „watchdog journalism“ oder Presse als vierter Gewalt im Staat hat die
derzeitige Arbeitsweise etlicher amerikanischer Journalisten nicht viel zu
tun. Bleibt abzuwarten, ob mit dem bevorstehenden Regierungswechsel auch
die Manipulationsversuche aus Weißem Haus und Pentagon aufhören, und ob eine
neue, quasi Nachkriegsadministration auch eine neue Ära des Journalismus
einläuten wird, eine Ära nach der Selbstzensur. |
Die Autorin

Anne-Katrin Arnold
Jahrgang 1978, hat in Hannover, London und Philadelphia
Kommunikationswissenschaft studiert und promoviert derzeit an der University
of Pennsylvania in Philadelphia. In Deutschland hat sie mehrere Jahre in
Zeitungs- und Radioredaktionen verbracht und widmet sich nach einem kurzen
Ausflug in die internationale Diplomatie nun wieder ganz der Wissenschaft.
Hier dreht sich ihre Arbeit um Öffentlichkeit, öffentliche Meinung und
Journalismus. |